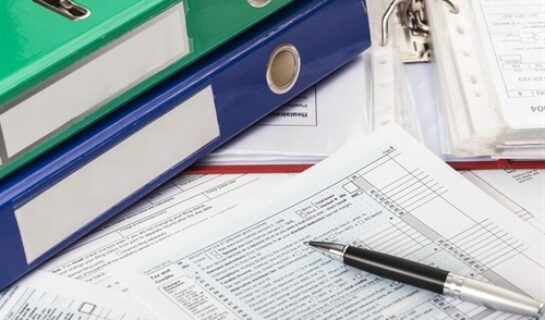Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Fall vor Gericht
- Erbstreit unter Geschwistern landet vor Gericht
- Der Hintergrund: Ein Testament kurz nach dem Tod des Ehemanns
- Inhalt des umstrittenen Testaments
- Der Konflikt: Gesetzliche Erbfolge versus Testament
- Die Entscheidung des Amtsgerichts Forchheim
- Das Beschwerdeverfahren vor dem OLG Bamberg
- Die Entscheidung des OLG Bamberg: Fokus auf den Inhalt des Erbscheins
- Kosten und Weiteres Vorgehen
- Bedeutung für Betroffene
- Die Schlüsselerkenntnisse
- Benötigen Sie Hilfe?
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Was bedeutet Testierfähigkeit und wann kann sie angezweifelt werden?
- Welche Rolle spielt der Erbschein und welche Informationen enthält er bezüglich der Erbfolge?
- Wie läuft ein Erbscheinsverfahren ab und welche Fristen sind zu beachten?
- Was bedeutet „gesetzliche Erbfolge“ im Gegensatz zur „gewillkürten Erbfolge“ und wie beeinflusst das ein Testament?
- Welche Möglichkeiten gibt es, ein Testament anzufechten und welche Beweise sind dafür erforderlich?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Hinweise und Tipps
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 2 W 5/21 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: OLG Bamberg
- Datum: 23.12.2021
- Aktenzeichen: 2 W 5/21
- Verfahrensart: Beschwerdeverfahren in einer Erbsache
- Rechtsbereiche: Erbrecht
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Zwei Kinder der Erblasserin (Beschwerdeführer), die die gesetzliche Erbfolge (jeder 1/3) beantragten und die Gültigkeit des Testaments anzweifelten.
- Beklagte: Ein Kind der Erblasserin (Beschwerdegegnerin), das einen Erbschein gemäß dem Testament beantragte.
Worum ging es in dem Fall?
- Sachverhalt: Eine Mutter verstarb und hinterließ ein handschriftliches Testament, in dem sie ihren drei Kindern (den Beteiligten) verschiedene Vermögenswerte zuwies und verfügte, dass der Rest zu gleichen Teilen aufgeteilt werden soll. Ein Ehemann war bereits vorverstorben.
- Kern des Rechtsstreits: Streit zwischen den drei Kindern der Verstorbenen darüber, ob das von ihr hinterlassene Testament gültig ist oder ob die gesetzliche Erbfolge eintritt. Zwei Kinder zweifelten die Testierfähigkeit der Mutter zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung an und beantragten einen Erbschein als gesetzliche Erben zu je 1/3. Das dritte Kind beantragte einen Erbschein auf Grundlage des Testaments.
Was wurde entschieden?
- Entscheidung: Die Beschwerde der zwei Kinder, die die gesetzliche Erbfolge beantragten, wurde zurückgewiesen. Das Gericht stellte jedoch fest, dass die notwendigen Tatsachen für die Erteilung von Erbscheinen gemäß den Anträgen aller drei Kinder (also auch basierend auf dem Testament) vorliegen. Die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen.
- Folgen: Die beiden Beschwerdeführer müssen die Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen. Der Streitwert wurde auf 666.666,00 € festgelegt. Da die Tatsachen für die Erteilung eines Erbscheins gemäß dem Testament als festgestellt gelten, kann ein entsprechender Erbschein ausgestellt werden (sofern keine Rechtsbeschwerde Erfolg hat). Gegen diesen Beschluss kann Rechtsbeschwerde eingelegt werden.
Der Fall vor Gericht
Erbstreit unter Geschwistern landet vor Gericht

Ein komplexer Erbstreit zwischen drei Geschwistern beschäftigte das Oberlandesgericht (OLG) Bamberg. Im Kern ging es um die Frage, ob das Erbe der verstorbenen Mutter auf Grundlage der gesetzlichen Erbfolge oder eines von ihr hinterlassenen Testaments verteilt werden sollte. Beide Wege führten zum selben Ergebnis – einer Erbquote von je einem Drittel für jedes Kind. Der Streit entzündete sich jedoch am rechtlichen Grund der Erbfolge.
Der Hintergrund: Ein Testament kurz nach dem Tod des Ehemanns
Die Mutter der drei Beteiligten verstarb im Jahr 2020, ihr Ehemann bereits 2016. Kurz nach dem Tod ihres Mannes, am 6. März 2016, verfasste sie ein eigenhändiges Testament. Dieses Testament wurde nach ihrem Tod eröffnet und bildete den Mittelpunkt der Auseinandersetzung.
Inhalt des umstrittenen Testaments
In ihrem letzten Willen verfügte die Erblasserin die Zuteilung spezifischer Immobilien und Vermögenswerte an ihre drei Kinder. Sohn (Beteiligter zu 1) und eine Tochter (Beteiligte zu 2) erhielten bestimmte Anwesen und Anteile. Die andere Tochter (Beteiligte zu 3) sollte ein spezifisches Anwesen schuldenfrei erhalten. Entscheidend war der vierte Punkt: „Der Rest soll zu gleichen Teilen an die 3 Kinder aufgeteilt werden!“.
Der Konflikt: Gesetzliche Erbfolge versus Testament
Obwohl das Testament letztlich, wie die gesetzliche Erbfolge, zu einer Drittelung des Resterbes führte, beantragten die Beteiligten unterschiedliche Erbscheine.
Position der Beteiligten 1 und 2: Zweifel an der Testierfähigkeit
Die Beteiligten zu 1) und 2) argumentierten, ihre Mutter sei zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung testierunfähig gewesen. Sie verwiesen auf den psychischen Ausnahmezustand der Mutter kurz nach dem Tod ihres Ehemanns, der durch eine anschließende Klinikaufnahme belegt sei. Auch Inhalt und Form des Testaments deuteten darauf hin, dass sie den Inhalt nicht voll erfasst habe.
Zudem fochten sie das Testament an, da es durch die Zuwendung an die Beteiligte zu 3) von der stets angestrebten Gleichbehandlung der Kinder abweiche. Sie beantragten daher einen Erbschein, der die gesetzliche Erbfolge (je 1/3) bescheinigt.
Position der Beteiligten 3: Gültigkeit des Testaments
Die Beteiligte zu 3) hielt das Testament für wirksam und ihre Mutter für testierfähig. Sie argumentierte, dass die anderen Geschwister bereits erhebliche Schenkungen erhalten hätten, weshalb die Zuwendung im Testament keine relevante Besserstellung darstelle. Sie beantragte ebenfalls einen Erbschein über je 1/3, jedoch auf Basis des Testaments (gewillkürte Erbfolge).
Die Entscheidung des Amtsgerichts Forchheim
Das Nachlassgericht in erster Instanz folgte der Argumentation der Beteiligten zu 3). Es erachtete die Tatsachen zur Begründung eines Erbscheins aufgrund des Testaments als festgestellt. Den Antrag der Beteiligten zu 1) und 2) auf einen Erbschein nach gesetzlicher Erbfolge wies es zurück. Das Gericht sah keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine Testierunfähigkeit der Erblasserin.
Das Beschwerdeverfahren vor dem OLG Bamberg
Gegen die Entscheidung des Amtsgerichts legten die Beteiligten zu 1) und 2) Beschwerde beim OLG Bamberg ein. Sie hielten an ihrer Auffassung fest, dass das Testament ungültig sei und die gesetzliche Erbfolge greifen müsse.
Die Entscheidung des OLG Bamberg: Fokus auf den Inhalt des Erbscheins
Das OLG Bamberg wies die Beschwerde der Beteiligten zu 1) und 2) zurück, traf jedoch eine wichtige Klarstellung (Maßgabe). Es stellte fest, dass die erforderlichen Tatsachen für alle drei Erbscheinsanträge als festgestellt gelten. Dies bedeutet: Obwohl die Gründe (gesetzlich vs. testamentarisch) strittig sind, ist das Ergebnis – Miterben zu je 1/3 – unstrittig und kann im Erbschein ausgewiesen werden.
Das Gericht betonte damit indirekt den gesetzlichen Inhalt eines Erbscheins. Dieser weist primär aus, wer Erbe geworden ist und zu welchem Anteil. Der genaue Berufungsgrund (gesetzlich oder testamentarisch) muss nicht zwingend im Erbschein selbst aufgeführt werden, insbesondere wenn beide Wege zum selben Ergebnis führen. Die Frage der Testierfähigkeit oder der Anfechtung wurde somit für die Erteilung des Erbscheins in dieser Form als nicht entscheidungserheblich betrachtet.
Kosten und Weiteres Vorgehen
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens wurden den Beschwerdeführern (Beteiligte 1 und 2) auferlegt. Der Beschwerdewert wurde auf beachtliche 666.666 Euro festgesetzt. Bemerkenswert ist, dass das OLG Bamberg die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof (BGH) zugelassen hat. Dies signalisiert, dass die Frage nach dem notwendigen Inhalt eines Erbscheins bei strittigem Berufungsgrund, aber gleichem Ergebnis, grundsätzliche Bedeutung hat.
Bedeutung für Betroffene
Klarheit trotz Streit über den Grund
Für die beteiligten Erben bedeutet die Entscheidung zunächst, dass sie einen Erbschein erhalten können, der ihre Erbteile von je einem Drittel ausweist. Dies ermöglicht ihnen, über den Nachlass zu verfügen, Bankgeschäfte zu tätigen oder Grundstücke umzuschreiben. Der Streit über die Gültigkeit des Testaments wird durch den Erbschein selbst nicht abschließend geklärt, aber für die praktische Abwicklung vorerst zurückgestellt.
Rechtsunsicherheit bleibt bestehen
Da der Grund der Erbfolge (gesetzlich oder testamentarisch) strittig bleibt und die Rechtsbeschwerde zugelassen wurde, ist der Konflikt möglicherweise nicht endgültig beigelegt. Sollte der BGH die Rechtsfrage anders beurteilen, könnte dies Auswirkungen auf die Auslegung und den Inhalt von Erbscheinen in ähnlichen Fällen haben. Die Frage der Testierfähigkeit könnte in einem anderen Verfahren (z.B. einer Feststellungsklage) erneut relevant werden.
Signalwirkung für ähnliche Fälle
Die Entscheidung verdeutlicht, dass Gerichte im Erbscheinsverfahren pragmatisch vorgehen können, wenn das Ergebnis (Erbquoten) unstrittig ist, auch wenn der Weg dorthin (Gesetz vs. Testament) umstritten ist. Für Testierende unterstreicht der Fall die Wichtigkeit, klare und unmissverständliche Testamente zu verfassen, um spätere Streitigkeiten über die Auslegung oder Gültigkeit zu vermeiden. Die Dokumentation der Testierfähigkeit zum Zeitpunkt der Errichtung kann ebenfalls hilfreich sein.
Die Schlüsselerkenntnisse
Das Urteil verdeutlicht, dass bei einem Erbscheinsverfahren der konkrete Berufungsgrund (Testament oder gesetzliche Erbfolge) nicht entscheidend ist, wenn die Erbquoten identisch sind – in diesem Fall erhielten alle drei Geschwister jeweils 1/3 des Erbes. Ein Erbschein weist nicht aus, ob er auf einem Testament oder der gesetzlichen Erbfolge beruht, was vielen Betroffenen nicht bewusst sein dürfte. Das Gericht muss daher nicht feststellen, ob die Erblasserin testierfähig war oder das Testament wirksam ist, solange die Erbanteile unstrittig sind – was die Rechtssicherheit erhöht und unnötige Streitigkeiten vermeidet.
Benötigen Sie Hilfe?
Erbschein beantragt? Streit über die Erbfolge?
Sie sind unsicher, ob die Erbfolge auf Grundlage des Gesetzes oder eines Testaments erfolgen soll? Oder droht ein Streit über die Testierfähigkeit des Erblassers? Diese Situationen können sehr belastend sein und die Abwicklung eines Nachlasses erheblich verzögern. Die rechtlichen Auseinandersetzungen sind oft komplex und erfordern eine genaue Kenntnis des Erbrechts.
Wir unterstützen Sie bei der Durchsetzung Ihrer Rechte im Erbfall. Unsere Erfahrung im Erbrecht ermöglicht es uns, Ihre individuelle Situation umfassend zu analysieren und Ihnen eine klare, verständliche Beratung anzubieten. Wir helfen Ihnen, Ihre Ansprüche geltend zu machen und eine faire Lösung zu finden – außergerichtlich oder vor Gericht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was bedeutet Testierfähigkeit und wann kann sie angezweifelt werden?
Testierfähigkeit bedeutet, dass eine Person geistig in der Lage ist, ein wirksames Testament zu erstellen oder einen Erbvertrag abzuschließen. Es ist die Fähigkeit zu verstehen, was ein Testament ist, welche Folgen es hat und frei darüber zu entscheiden, wer das eigene Vermögen nach dem Tod erhalten soll.
Grundsätzlich gilt: Jede Person, die volljährig (18 Jahre alt) ist, wird als testierfähig angesehen. Eine Ausnahme besteht für Minderjährige ab 16 Jahren, die ein Testament vor einem Notar oder durch Übergabe einer offenen Schrift errichten können (§ 2229 Abs. 1, § 2247 Abs. 4 BGB). Die Fähigkeit, ein Testament zu machen, ist also die Regel.
Voraussetzungen für Testierfähigkeit
Damit eine Person als testierfähig gilt, muss sie im Wesentlichen Folgendes können:
- Verstehen, was ein Testament bewirkt: Die Person muss begreifen, dass sie mit dem Testament Regelungen für ihr Vermögen nach ihrem Tod trifft und wer dadurch begünstigt oder benachteiligt wird.
- Eine freie Entscheidung treffen: Die Person muss in der Lage sein, ihren Willen frei von unzulässiger Beeinflussung durch andere oder aufgrund von Wahnvorstellungen zu bilden und danach zu handeln. Sie muss verstehen, welche persönlichen oder familiären Bindungen bestehen und wie sich ihre Entscheidung darauf auswirkt.
Es geht also nicht darum, ob die Entscheidung im Testament „vernünftig“ oder „gerecht“ erscheint, sondern nur darum, ob die Person zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung die geistige Fähigkeit zur freien und überlegten Entscheidung hatte.
Wann liegt Testierunfähigkeit vor?
Die Testierfähigkeit kann fehlen, wenn die geistigen Fähigkeiten einer Person zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung erheblich beeinträchtigt sind. Das Gesetz (§ 2229 Abs. 4 BGB) nennt hierfür bestimmte Gründe:
- Krankhafte Störung der Geistestätigkeit: Dies umfasst schwere psychische Erkrankungen wie fortgeschrittene Demenz (z.B. Alzheimer), Schizophrenie oder schwere Depressionen, wenn sie die freie Willensbildung ausschließen.
- Geistesschwäche: Hiermit sind angeborene oder erworbene Intelligenzminderungen gemeint, die so ausgeprägt sind, dass die Tragweite eines Testaments nicht erfasst werden kann.
- Bewusstseinsstörung: Darunter fallen vorübergehende Zustände wie starker Alkohol- oder Drogeneinfluss, hohes Fieber mit Delirium oder die Auswirkungen starker Medikamente, wenn sie die Person daran hindern, klar zu denken und frei zu entscheiden.
Wichtig ist: Nicht jede Krankheit oder jedes hohe Alter führt automatisch zur Testierunfähigkeit. Eine Person kann beispielsweise trotz einer beginnenden Demenz oder einer anderen Erkrankung in einem „lichten Moment“ (lucidum intervallum) durchaus testierfähig sein. Entscheidend ist immer der geistige Zustand genau im Moment der Testamentserrichtung.
Wer muss die Testierunfähigkeit beweisen?
Im Rechtsstreit, beispielsweise in einem Erbscheinsverfahren oder bei einem Streit unter Erben (wie Geschwistern), gilt zunächst die Vermutung, dass der Erblasser testierfähig war.
Wer also behauptet, das Testament sei unwirksam, weil der Erblasser testierunfähig war, muss dies beweisen. Das ist oft schwierig, da der Zustand des Erblassers nachträglich beurteilt werden muss. Häufig werden dafür ärztliche Unterlagen, Zeugenaussagen oder Sachverständigengutachten herangezogen, um den geistigen Zustand zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung zu klären. Zweifel an der Testierfähigkeit sind daher ein häufiger und zentraler Punkt in Auseinandersetzungen um die Gültigkeit eines Testaments.
Welche Rolle spielt der Erbschein und welche Informationen enthält er bezüglich der Erbfolge?
Der Erbschein ist ein offizielles Dokument, das vom zuständigen Nachlassgericht (meist Teil des Amtsgerichts) auf Antrag ausgestellt wird. Er dient als amtlicher Nachweis darüber, wer Erbe einer verstorbenen Person geworden ist.
Was ist der Zweck des Erbscheins?
Stellen Sie sich vor, Sie müssen nach einem Todesfall auf das Konto des Verstorbenen zugreifen oder ein Grundstück auf Ihren Namen umschreiben lassen. Behörden, Banken oder Geschäftspartner benötigen einen verlässlichen Beweis dafür, dass Sie tatsächlich der berechtigte Erbe sind. Genau hier kommt der Erbschein ins Spiel: Er legitimiert Sie als Erben im Rechtsverkehr. Mit einem Erbschein können Sie beispielsweise:
- Konten des Erblassers auflösen oder umschreiben lassen.
- Verträge des Erblassers kündigen.
- Das Grundbuch berichtigen lassen, wenn Immobilien zum Erbe gehören.
Welche Informationen stehen im Erbschein?
Der Erbschein enthält die wesentlichen Informationen zur Erbfolge:
- Wer ist Erbe? Der Erbschein nennt den oder die Erben namentlich.
- Wie groß ist der Erbteil? Bei mehreren Erben (einer Erbengemeinschaft) weist der Erbschein auch aus, zu welchem Anteil jeder einzelne Erbe am Nachlass beteiligt ist. Diesen Anteil nennt man Erbquote (z. B. Erbe zu ½, Erbe zu ¼).
- Gibt es Beschränkungen? Manchmal enthält der Erbschein auch Hinweise auf besondere Anordnungen des Erblassers, wie zum Beispiel die Einsetzung eines Testamentsvollstreckers oder die Anordnung einer Nacherbschaft (d.h., dass der Nachlass nach dem Tod des ersten Erben an eine andere Person fallen soll).
Worauf stützt sich der Inhalt des Erbscheins?
Das Nachlassgericht prüft im Erbscheinsverfahren, wer nach dem Gesetz oder nach dem letzten Willen des Verstorbenen Erbe geworden ist. Der Erbschein basiert daher entweder auf:
- Der gesetzlichen Erbfolge: Wenn der Verstorbene kein gültiges Testament oder keinen Erbvertrag hinterlassen hat, gilt die gesetzliche Erbfolge. Der Erbschein weist dann die nach den gesetzlichen Regeln (Verwandtschaftsgrad, Ehegattenstatus) ermittelten Erben und ihre Quoten aus.
- Einem Testament oder Erbvertrag: Hat der Verstorbene seinen letzten Willen in einem Testament oder Erbvertrag festgelegt (sogenannte gewillkürte Erbfolge), dann stellt der Erbschein fest, wer nach diesem Dokument Erbe ist und welche Erbteile gelten.
Der Erbschein spiegelt also wider, welche Erbfolge das Nachlassgericht nach Prüfung der Sachlage (Gesetz oder Testament) festgestellt hat.
Ist der Erbschein endgültig und unanfechtbar?
Obwohl der Erbschein ein amtliches Zeugnis ist und im Rechtsverkehr großes Vertrauen genießt (man spricht von einer Vermutung der Richtigkeit), ist er nicht unumstößlich oder absolut endgültig.
- Korrekturmöglichkeit: Stellt sich später heraus, dass der Erbschein fehlerhaft ist – zum Beispiel, weil ein neueres Testament auftaucht, ein Testament erfolgreich angefochten wird oder die gesetzliche Erbfolge falsch beurteilt wurde –, kann das Nachlassgericht den Erbschein wieder einziehen und für kraftlos erklären.
- Bedeutung bei Streitigkeiten: Gerade in Fällen, in denen es Streit über die Gültigkeit oder Auslegung eines Testaments gibt, etwa unter Geschwistern, ist die Frage der Richtigkeit des Erbscheins oft zentral. Ein bereits erteilter Erbschein kann im Laufe eines solchen Streits seine Gültigkeit verlieren, wenn sich herausstellt, dass er nicht die tatsächliche Erbfolge korrekt wiedergibt.
Der Erbschein schafft also eine wichtige, aber nicht unumstößliche Klarheit über die Erbensituation.
Wie läuft ein Erbscheinsverfahren ab und welche Fristen sind zu beachten?
Ein Erbscheinsverfahren dient dazu, offiziell festzustellen, wer Erbe geworden ist. Der Erbschein ist ein amtliches Zeugnis, das vom Nachlassgericht ausgestellt wird und den oder die Erben sowie die Größe ihres Erbteils ausweist. Dieses Dokument benötigen Erben oft, um sich gegenüber Banken, Versicherungen oder dem Grundbuchamt als Rechtsnachfolger des Verstorbenen (Erblassers) ausweisen zu können.
Wie wird das Verfahren eingeleitet?
Das Verfahren beginnt nicht automatisch, sondern nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist in der Regel jeder, der glaubt, Erbe geworden zu sein. Auch ein Testamentsvollstrecker oder Nachlassverwalter kann den Antrag stellen.
Der Antrag muss beim zuständigen Nachlassgericht gestellt werden. Das ist üblicherweise das Amtsgericht am letzten offiziellen Wohnsitz des Erblassers. Sie können den Antrag entweder persönlich beim Gericht zu Protokoll geben oder durch einen Notar beurkunden lassen. Ein einfacher schriftlicher Antrag per Brief reicht meist nicht aus, da bestimmte Angaben an Eides statt versichert werden müssen.
Im Antrag müssen Sie verschiedene Informationen angeben, unter anderem:
- Daten des Verstorbenen (Name, letzter Wohnsitz, Todestag)
- Ihre eigenen Daten und Ihr Verhältnis zum Verstorbenen (z.B. Kind, Ehepartner)
- Angaben dazu, ob es weitere mögliche Erben gibt
- Informationen darüber, ob ein Testament oder ein Erbvertrag existiert und wo es sich befindet
- Die Grundlage Ihrer Erbenstellung (gesetzliche Erbfolge oder Testament/Erbvertrag)
Welche Dokumente werden benötigt?
Dem Antrag müssen in der Regel folgende Unterlagen beigefügt werden (im Original oder als beglaubigte Kopie):
- Sterbeurkunde des Erblassers
- Ihr gültiger Personalausweis oder Reisepass
- Wenn die Erbfolge auf einem Testament oder Erbvertrag beruht: das entsprechende Dokument im Original.
- Wenn die gesetzliche Erbfolge gilt (also kein Testament vorhanden ist oder dieses ungültig ist): Personenstandsurkunden wie Geburtsurkunden, Heiratsurkunden oder ein Familienstammbuch, um die Verwandtschaftsverhältnisse nachzuweisen.
Wie prüft das Nachlassgericht?
Das Nachlassgericht prüft von Amts wegen, wer tatsächlich Erbe geworden ist. Es sichtet die eingereichten Unterlagen und ermittelt die Erbfolge.
- Bei gesetzlicher Erbfolge: Das Gericht prüft die Verwandtschaftsverhältnisse anhand der Urkunden.
- Bei einem Testament oder Erbvertrag: Das Gericht prüft, ob das Dokument gültig ist (z.B. formgerecht erstellt, Testierfähigkeit des Erblassers). Es legt den Inhalt aus, um den Willen des Erblassers zu ermitteln.
Gerade wenn es Streit unter möglichen Erben gibt, zum Beispiel unter Geschwistern über die Gültigkeit oder Auslegung eines Testaments, wird das Verfahren komplexer. Das Gericht hört dann oft alle Beteiligten an. Es kann auch weitere Ermittlungen durchführen, beispielsweise Zeugen befragen oder Gutachten einholen (z.B. zur Echtheit einer Unterschrift oder zur Testierfähigkeit). Ziel ist es, die tatsächliche Erbfolge zweifelsfrei festzustellen. Widersprechen sich die Angaben oder Anträge verschiedener Personen, muss das Gericht entscheiden, wer Erbe ist.
Am Ende des Verfahrens erlässt das Gericht entweder den beantragten Erbschein oder weist den Antrag zurück, wenn es zu dem Ergebnis kommt, dass der Antragsteller nicht (oder nicht allein) Erbe ist.
Welche Fristen sind wichtig?
Im Zusammenhang mit einem Erbfall und dem Erbscheinsverfahren sind vor allem folgende Fristen relevant:
- Frist zur Ausschlagung der Erbschaft: Diese beträgt sechs Wochen. Sie beginnt in der Regel ab dem Zeitpunkt, an dem Sie erfahren, dass Sie Erbe geworden sind und worauf Ihre Erbenstellung beruht (z.B. durch Kenntnis eines Testaments oder der gesetzlichen Erbfolge). Schlagen Sie die Erbschaft nicht fristgerecht aus, gelten Sie als Erbe – auch mit eventuellen Schulden. Die Ausschlagung muss gegenüber dem Nachlassgericht erklärt werden.
- Anfechtungsfrist für ein Testament: Wenn Sie glauben, dass ein Testament ungültig ist (z.B. wegen Drohung, Täuschung oder weil der Erblasser nicht testierfähig war), können Sie es anfechten. Die Anfechtungsfrist beträgt ein Jahr ab dem Zeitpunkt, an dem Sie vom Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt haben (§ 2082 BGB). Eine Anfechtung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht.
- Frist zur Beantragung des Erbscheins: Es gibt keine gesetzliche Frist, innerhalb derer Sie einen Erbschein beantragen müssen. Allerdings ist es oft praktisch notwendig, den Antrag zeitnah zu stellen, um handlungsfähig zu sein (z.B. Zugriff auf Konten).
- Fristen im Verfahren: Das Nachlassgericht kann den Beteiligten im Laufe des Verfahrens Fristen setzen, beispielsweise um Stellungnahmen abzugeben oder Unterlagen einzureichen. Diese Fristen sollten unbedingt eingehalten werden.
Das Erbscheinsverfahren kann, insbesondere bei Streitigkeiten, einige Zeit in Anspruch nehmen.
Was bedeutet „gesetzliche Erbfolge“ im Gegensatz zur „gewillkürten Erbfolge“ und wie beeinflusst das ein Testament?
Wenn eine Person verstirbt, muss geklärt werden, wer ihr Vermögen erbt. Hier gibt es zwei grundlegende Wege: die gesetzliche Erbfolge und die gewillkürte Erbfolge.
Die gesetzliche Erbfolge: Wenn das Gesetz entscheidet
Stellen Sie sich vor, jemand hinterlässt kein Testament oder keinen Erbvertrag. In diesem Fall tritt automatisch die gesetzliche Erbfolge in Kraft. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) legt dann genau fest, wer erbt und in welcher Reihenfolge.
- Wer erbt? Die gesetzliche Erbfolge basiert auf Verwandtschaftsgraden (sogenannten Ordnungen) und dem Ehe- bzw. Lebenspartnerschaftsrecht.
- Erben erster Ordnung: Das sind die direkten Abkömmlinge des Verstorbenen, also Kinder, Enkel, Urenkel.
- Erben zweiter Ordnung: Gibt es keine Erben erster Ordnung, erben die Eltern des Verstorbenen und deren Abkömmlinge (also Geschwister, Neffen, Nichten des Verstorbenen).
- Weitere Ordnungen: Gibt es auch keine Erben zweiter Ordnung, kommen entferntere Verwandte zum Zug.
- Ehegatten/Lebenspartner: Der überlebende Ehegatte oder eingetragene Lebenspartner hat ein eigenes gesetzliches Erbrecht, dessen Höhe davon abhängt, welche Verwandten noch vorhanden sind und in welchem Güterstand die Partner lebten.
- Wann greift sie? Die gesetzliche Erbfolge gilt immer dann, wenn der Verstorbene keine eigenen, gültigen Anordnungen für sein Erbe getroffen hat.
Die gewillkürte Erbfolge: Wenn der eigene Wille zählt
Im Gegensatz dazu steht die gewillkürte Erbfolge. Hier hat der Verstorbene zu Lebzeiten selbst bestimmt, wer sein Erbe erhalten soll. „Gewillkürt“ bedeutet „durch den eigenen Willen bestimmt“.
- Wie wird sie festgelegt? Dies geschieht hauptsächlich durch ein Testament (auch „letztwillige Verfügung“ genannt) oder einen Erbvertrag. In diesen Dokumenten kann der Erblasser (die Person, die vererbt) von der gesetzlichen Erbfolge abweichen.
- Was kann man regeln? Sie können Personen als Erben einsetzen, die nach dem Gesetz gar nicht erben würden (z.B. Freunde, nichteheliche Lebenspartner). Sie können auch die Erbteile anders verteilen, als es das Gesetz vorsieht, oder bestimmte Gegenstände einzelnen Personen zuweisen (Vermächtnis).
Vorrang des Testaments
Der entscheidende Punkt ist: Ein gültiges Testament (oder ein Erbvertrag) hat grundsätzlich Vorrang vor der gesetzlichen Erbfolge. Ihr persönlicher letzter Wille, den Sie in einem Testament niederlegen, setzt die allgemeinen Regeln des Gesetzes außer Kraft. Das Gesetz respektiert Ihre Entscheidung, wie Ihr Vermögen verteilt werden soll.
Was passiert bei einem unwirksamen oder angefochtenen Testament?
Es kann vorkommen, dass ein Testament unwirksam ist, zum Beispiel weil es nicht die vorgeschriebene Form hat (etwa nicht handschriftlich unterschrieben ist) oder weil der Erblasser zum Zeitpunkt der Erstellung nicht mehr testierfähig (also nicht bei klarem Verstand) war. Ein Testament kann auch nach dem Tod angefochten werden, wenn bestimmte Gründe vorliegen (z.B. Irrtum, Täuschung, Drohung).
- Folge: Ist ein Testament unwirksam oder wird es erfolgreich angefochten, so ist es (ganz oder teilweise) nichtig. Das bedeutet, es wird so behandelt, als hätte es dieses Testament nicht gegeben.
- Konsequenz für die Erbfolge: In diesem Fall greift wieder die gesetzliche Erbfolge, es sei denn, es gibt ein früheres, gültiges Testament des Verstorbenen. Die Erbfolge richtet sich dann nach den gesetzlichen Regeln, als hätte der Erblasser keine eigene Verfügung getroffen.
Bedeutung im Erbscheinsverfahren und bei Streitigkeiten
Der Unterschied zwischen gesetzlicher und gewillkürter Erbfolge ist zentral, wenn es darum geht, wer offiziell als Erbe anerkannt wird.
- Erbscheinsverfahren: Um sich als Erbe ausweisen zu können (z.B. gegenüber Banken oder dem Grundbuchamt), benötigt man oft einen Erbschein. Das Nachlassgericht prüft, wer Erbe geworden ist. Liegt ein Testament vor, prüft das Gericht dessen Gültigkeit und stellt den Erbschein entsprechend der gewillkürten Erbfolge aus. Gibt es kein (gültiges) Testament, wird der Erbschein nach den Regeln der gesetzlichen Erbfolge erteilt.
- Testamentstreit unter Geschwistern (oder anderen Erben): Gerade wenn ein Testament vorliegt, das von der gesetzlichen Erbfolge abweicht, kann es zu Streitigkeiten kommen. Oft geht es dabei um die Frage, ob das Testament überhaupt gültig ist, ob es richtig ausgelegt wird oder ob es erfolgreich angefochten werden kann. Das Ergebnis dieses Streits entscheidet darüber, ob die im Testament festgelegte (gewillkürte) Erbfolge gilt oder ob doch die gesetzliche Erbfolge zum Tragen kommt. Dies bestimmt dann, wer wie viel erbt.
Welche Möglichkeiten gibt es, ein Testament anzufechten und welche Beweise sind dafür erforderlich?
Ein Testament kann unter bestimmten Voraussetzungen angefochten werden, wenn Zweifel an seiner Gültigkeit bestehen. Eine Anfechtung ist jedoch nur möglich, wenn gesetzlich anerkannte Anfechtungsgründe vorliegen und sollte nicht leichtfertig erfolgen. Sie muss gut begründet sein.
Gründe für eine Testamentsanfechtung
Das Gesetz sieht verschiedene Gründe vor, aus denen ein Testament angefochten werden kann:
- Testierunfähigkeit (§ 2229 Abs. 4 BGB):
- Dies ist der Fall, wenn der Erblasser zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung nicht mehr in der Lage war, die Bedeutung seiner Entscheidung zu verstehen und vernünftig zu handeln. Gründe können beispielsweise eine fortgeschrittene Demenz, eine schwere psychische Erkrankung oder starker Einfluss von Rauschmitteln sein.
- Entscheidend ist der Zustand genau zum Zeitpunkt, als das Testament gemacht wurde. War der Erblasser nur vorübergehend verwirrt, aber bei der Unterschrift klar bei Verstand, liegt in der Regel keine Testierunfähigkeit vor.
- Irrtum (§ 2078 BGB):
- Ein Testament kann angefochten werden, wenn sich der Erblasser bei der Abfassung geirrt hat. Man unterscheidet verschiedene Irrtümer:
- Erklärungsirrtum: Der Erblasser wollte etwas anderes schreiben, als er tatsächlich geschrieben hat (z.B. Verschreiben bei einer Summe).
- Inhaltsirrtum: Der Erblasser wusste, was er schreibt, aber er hat sich über die Bedeutung seiner Worte geirrt (z.B. er verwendet einen Begriff falsch).
- Motivirrtum: Der Erblasser ging von falschen Tatsachen oder Erwartungen aus, die ihn dazu bewogen haben, das Testament so zu schreiben (z.B. er enterbt ein Kind, weil er fälschlicherweise glaubt, es habe ihn bestohlen).
- Wichtig ist: Es muss angenommen werden, dass der Erblasser das Testament so nicht geschrieben hätte, wenn er den Irrtum erkannt hätte.
- Ein Testament kann angefochten werden, wenn sich der Erblasser bei der Abfassung geirrt hat. Man unterscheidet verschiedene Irrtümer:
- Drohung oder Täuschung (§ 2078 BGB):
- Eine Anfechtung ist möglich, wenn der Erblasser das Testament nur deshalb so geschrieben hat, weil er dazu gezwungen (bedroht) wurde oder weil man ihn arglistig getäuscht hat.
- Beispiel: Jemand droht dem Erblasser mit Nachteilen, wenn er ihn nicht als Erben einsetzt, oder jemand erzählt dem Erblasser bewusst Lügen über eine Person, um zu erreichen, dass diese enterbt wird.
- Übergehen eines Pflichtteilsberechtigten (§ 2079 BGB):
- Hat der Erblasser einen Pflichtteilsberechtigten (z.B. ein Kind, Ehepartner) in seinem Testament übergangen, von dessen Existenz er bei der Testamentserrichtung nichts wusste oder der erst nach der Testamentserrichtung pflichtteilsberechtigt wurde (z.B. durch Geburt oder Heirat), kann dieser Übergangene das Testament anfechten.
- Dies gilt nicht, wenn anzunehmen ist, dass der Erblasser auch bei Kenntnis der Person kein anderes Testament verfasst hätte.
Wer kann anfechten und innerhalb welcher Frist?
Anfechten darf nur derjenige, dem die Aufhebung des Testaments einen Vorteil bringen würde. Das sind meist gesetzliche Erben, die ohne das Testament erben würden, oder Personen, die in einem früheren Testament bedacht wurden.
Die Anfechtung muss gegenüber dem Nachlassgericht erklärt werden. Dafür gibt es eine Frist von einem Jahr (§ 2082 BGB). Diese Frist beginnt in dem Moment, in dem der Anfechtungsberechtigte verlässliche Kenntnis vom Anfechtungsgrund erlangt hat. Unabhängig von dieser Kenntnis ist eine Anfechtung spätestens 30 Jahre nach dem Erbfall ausgeschlossen.
Erforderliche Beweise
Derjenige, der das Testament anficht, muss die Anfechtungsgründe beweisen. Das ist oft die größte Herausforderung, insbesondere wenn es um die Testierunfähigkeit oder eine Drohung/Täuschung geht, die möglicherweise lange zurückliegt.
Als Beweismittel kommen in Betracht:
- Zeugenaussagen: Aussagen von Personen, die den Zustand des Erblassers zur Zeit der Testamentserstellung beurteilen können (z.B. Ärzte, Pflegekräfte, Nachbarn, Freunde, Familienmitglieder) oder die Umstände der Testamentserrichtung miterlebt haben.
- Urkunden: Ärztliche Unterlagen (Atteste, Krankenakten), Gutachten, Pflegeberichte, Briefe, E-Mails oder Notizen des Erblassers können wichtige Hinweise geben.
- Sachverständigengutachten: Insbesondere bei der Frage der Testierunfähigkeit wird oft ein medizinisches oder psychiatrisches Gutachten durch einen Sachverständigen erforderlich. Dieser beurteilt den Zustand des Erblassers rückblickend anhand der vorliegenden Beweismittel (Urkunden, Zeugenaussagen).
Bloße Vermutungen oder ein Gefühl der Ungerechtigkeit reichen für eine erfolgreiche Anfechtung nicht aus. Es müssen konkrete Tatsachen vorgetragen und bewiesen werden, die den Anfechtungsgrund stützen. Gerade in Auseinandersetzungen zwischen Erben, wie z.B. Geschwistern im Rahmen eines Erbscheinsverfahrens, prüft das Nachlassgericht die vorgebrachten Anfechtungsgründe und Beweise sehr genau, bevor es über die Gültigkeit des Testaments entscheidet.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung ersetzen kann. Haben Sie konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir beraten Sie gerne.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
rechtlicher Grund der Erbfolge
Der rechtliche Grund der Erbfolge bezeichnet die juristische Basis, warum eine Person Erbe wird. Man unterscheidet hauptsächlich zwischen der gesetzlichen Erbfolge, die eintritt, wenn kein gültiges Testament vorliegt (§§ 1924 ff. BGB), und der gewillkürten Erbfolge, wenn der Erblasser seinen letzten Willen in einem Testament oder Erbvertrag festgelegt hat (§ 1937 BGB). Im vorliegenden Fall stritten die Geschwister genau darüber: Sollte das Erbe aufgrund des Testaments der Mutter (gewillkürte Erbfolge) oder aufgrund der gesetzlichen Regeln (gesetzliche Erbfolge) verteilt werden? Obwohl beide Wege zum gleichen Erbanteil (je 1/3) führten, war der Grund der Berufung zum Erben umstritten.
eigenhändiges Testament
Ein eigenhändiges Testament ist eine Form des Testaments, das der Erblasser persönlich und vollständig mit der Hand schreiben sowie am Ende unterschreiben muss (§ 2247 BGB). Die Angabe von Ort und Datum wird empfohlen, ist aber nicht zwingend für die Gültigkeit, kann aber bei mehreren Testamenten wichtig sein. Im Fall der Geschwister hat die Mutter kurz nach dem Tod ihres Mannes ein solches Testament verfasst, dessen Wirksamkeit von zwei Kindern angezweifelt wurde. Die strenge Formvorschrift soll sicherstellen, dass der Wille tatsächlich vom Erblasser stammt und dieser die Tragweite seiner Verfügung überblickt.
Beispiel: Wenn jemand seinen letzten Willen auf einem Blatt Papier komplett von Hand schreibt und unterschreibt, handelt es sich um ein eigenhändiges Testament. Ein am Computer getipptes und nur unterschriebenes Dokument wäre als eigenhändiges Testament formunwirksam.
Testierunfähigkeit
Testierunfähigkeit bedeutet, dass eine Person rechtlich nicht in der Lage ist, ein wirksames Testament zu errichten oder aufzuheben. Dies liegt vor, wenn sie wegen krankhafter Störung der Geistestätigkeit, wegen Geistesschwäche oder wegen Bewusstseinsstörung nicht verstehen kann, welche Bedeutung ihre Erklärung hat, oder nicht fähig ist, nach dieser Einsicht zu handeln (§ 2229 Abs. 4 BGB). Im konkreten Fall argumentierten zwei Geschwister, ihre Mutter sei zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung aufgrund des psychischen Ausnahmezustands nach dem Tod ihres Mannes testierunfähig gewesen. Die Beweislast für die Testierunfähigkeit liegt bei demjenigen, der sich darauf beruft und die Ungültigkeit des Testaments geltend macht.
gesetzliche Erbfolge
Die gesetzliche Erbfolge regelt, wer Erbe wird, wenn eine Person stirbt, ohne ein gültiges Testament oder einen Erbvertrag hinterlassen zu haben (§§ 1924 ff. BGB). Das Gesetz bestimmt die Erbfolge anhand einer Rangordnung der Verwandten (sogenannte Ordnungen: Kinder und Enkel, dann Eltern und Geschwister usw.) sowie des Ehegattenerbrechts. Im Fall der Geschwister wäre die gesetzliche Erbfolge zur Anwendung gekommen, falls das Testament der Mutter für ungültig erklärt worden wäre. Sie hätte hier ebenfalls dazu geführt, dass die drei Kinder als Erben erster Ordnung zu gleichen Teilen (je 1/3) erben.
Erbschein
Der Erbschein ist ein amtliches Zeugnis, ausgestellt vom Nachlassgericht, das bestätigt, wer Erbe einer verstorbenen Person geworden ist und wie groß der jeweilige Erbteil ist (§ 2353 BGB). Er dient als Nachweis der Erbenstellung im Rechtsverkehr, beispielsweise gegenüber Banken, Versicherungen oder dem Grundbuchamt, um über den Nachlass verfügen zu können. Im Fall der Geschwister beantragten alle drei einen Erbschein, der sie als Miterben zu je 1/3 ausweist. Das OLG Bamberg entschied, dass dieser Erbschein erteilt werden kann, da die Erbquoten unstrittig waren, auch wenn der zugrundeliegende Berufungsgrund (Testament oder Gesetz) strittig blieb.
Anfechtung (des Testaments)
Die Anfechtung eines Testaments ist die rechtliche Möglichkeit, die Gültigkeit einer letztwilligen Verfügung nach dem Tod des Erblassers gerichtlich überprüfen und gegebenenfalls für unwirksam erklären zu lassen. Anfechtungsgründe können zum Beispiel Irrtum des Erblassers (z.B. über den Inhalt seiner Erklärung oder über wesentliche Umstände), arglistige Täuschung oder widerrechtliche Drohung sein (§§ 2078 ff. BGB). Im Text fochten die Beteiligten 1) und 2) das Testament unter anderem an, weil es von der (von ihnen behaupteten) stets angestrebten Gleichbehandlung der Kinder abwich, was möglicherweise als Motivirrtum gewertet werden könnte. Eine erfolgreiche Anfechtung führt zur Nichtigkeit des angefochtenen Teils des Testaments oder des gesamten Testaments.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- § 2229 BGB (Testierfähigkeit): Dieses Gesetz bestimmt, wer ein Testament errichten darf. Wer krankheitsbedingt nicht verstehen kann, was ein Testament bedeutet und welche Folgen es hat, ist testierunfähig und kann kein gültiges Testament machen. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Beteiligten zu 1) und 2) argumentieren, dass die Mutter zum Zeitpunkt des Testaments nicht testierfähig war. Das Gericht musste prüfen, ob sie die Tragweite ihrer Entscheidung verstanden hat.
- § 2247 BGB (Eigenhändiges Testament): Regelt die Form eines handschriftlichen Testaments. Es muss komplett handschriftlich geschrieben und unterschrieben sein, um sicherzustellen, dass es wirklich der letzte Wille des Verstorbenen ist. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Testament der Mutter ist handschriftlich, was grundsätzlich eine gültige Form darstellt, aber die Frage der Testierfähigkeit bleibt entscheidend für die Wirksamkeit.
- § 1937 BGB (Gewillkürte Erbfolge): Dieses Gesetz erlaubt es jedem, durch ein Testament oder einen Erbvertrag selbst zu bestimmen, wer das Vermögen nach dem Tod erhalten soll. Das Testament setzt die gesetzliche Erbfolge außer Kraft. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Beteiligte zu 3) pocht auf das Testament als Grundlage der Erbfolge, während die anderen beiden Geschwister die gesetzliche Erbfolge bevorzugen würden, falls das Testament ungültig ist.
Hinweise und Tipps
Praxistipps für Erben bei Streitigkeiten über ein Testament trotz gleicher Erbquoten
Ein Erbe kann Familien zusammenführen oder auch entzweien. Manchmal entsteht heftiger Streit zwischen den Erben, selbst wenn am Ende jeder den gleichen Anteil erhalten soll. Unklarheiten im Testament oder das Gefühl ungerechter Behandlung können der Auslöser sein, auch wenn es rechnerisch keinen Unterschied macht.
Hinweis: Diese Praxistipps stellen keine Rechtsberatung dar. Sie ersetzen keine individuelle Prüfung durch eine qualifizierte Kanzlei. Jeder Einzelfall kann Besonderheiten aufweisen, die eine abweichende Einschätzung erfordern.
Tipp 1: Kostenrisiko bei Streit prüfen: Lohnt sich der Kampf ums Prinzip?
Auch wenn Sie am Ende rechnerisch den gleichen Erbteil erhalten würden – ein Streit vor Gericht über die Gültigkeit eines Testaments kann erhebliche Kosten verursachen. Wie der Fall zeigt, können Streitwerte sehr hoch sein (hier über 600.000 €), was zu hohen Anwalts- und Gerichtskosten führt. Wägen Sie ab, ob der emotionale Grund für den Streit (z. B. das Gefühl, übergangen worden zu sein) die finanziellen Risiken und den Familienzwist rechtfertigt, besonders wenn das Ergebnis finanziell identisch ist.
⚠️ ACHTUNG: Wer im Erbscheinsverfahren oder einem Prozess unterliegt, trägt in der Regel die Kosten – auch die der Gegenseite.
Tipp 2: Gültigkeit des Testaments prüfen: Form und Fähigkeit des Erblassers.
Wenn Sie Zweifel an einem Testament haben, prüfen Sie zunächst die formalen Anforderungen. Ein handschriftliches Testament muss vollständig vom Erblasser handgeschrieben und unterschrieben sein. Bestehen Zweifel an der Testierfähigkeit (also der geistigen Fähigkeit des Erblassers zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung), benötigen Sie stichhaltige Beweise.
⚠️ ACHTUNG: Die Beweislast für eine fehlende Testierfähigkeit liegt bei demjenigen, der sich darauf beruft. Das ist oft schwer zu beweisen, insbesondere ohne ärztliche Gutachten aus der Zeit der Testamentserstellung.
Tipp 3: Erbscheinsantrag strategisch stellen: Testament oder Gesetz?
Es ist möglich, dass verschiedene Erben unterschiedliche Erbscheine beantragen (z. B. einer auf Basis des Testaments, der andere auf Basis der gesetzlichen Erbfolge). Das Gericht prüft dann die Voraussetzungen für alle Anträge. Sprechen Sie mit einem Anwalt darüber, welcher Antrag in Ihrer Situation sinnvoll ist und welche Nachweise Sie benötigen. Manchmal stellt das Gericht – wie im Beispielfall – fest, dass die Voraussetzungen für beide Arten von Erbscheinen vorliegen könnten, was den Streit nicht sofort beendet.
Tipp 4: Frühzeitig Rechtsrat einholen: Eskalation verhindern.
Gerade wenn die Erbquoten gleich sind, aber Streit über den Weg dorthin (Testament vs. Gesetz) oder über die Motive des Erblassers besteht, kann eine frühe anwaltliche Beratung helfen. Ein Anwalt kann die Rechtslage objektiv einschätzen, Ihre Optionen aufzeigen und möglicherweise helfen, eine außergerichtliche Einigung zu finden, bevor hohe Kosten entstehen und der Familienfrieden dauerhaft zerstört wird.
Weitere Fallstricke oder Besonderheiten?
Der vorgestellte Fall zeigt eindrücklich, dass Erbstreitigkeiten nicht immer nur ums Geld gehen. Die Art und Weise, wie Vermögen verteilt wird (durch Testament oder Gesetz) und die wahrgenommenen Absichten des Erblassers können ebenso viel Konfliktpotenzial bergen wie die Erbteile selbst. Ein weiterer Fallstrick ist die Unterschätzung der Schwierigkeit, eine Testierunfähigkeit nachzuweisen, was oft zu langwierigen und teuren Verfahren führt.
✅ Checkliste: Streit über Testament trotz gleicher Quoten
- Testament prüfen: Liegt ein formgültiges Testament vor? Ist der Inhalt eindeutig?
- Erbfolge klären: Was sieht das Testament vor, was die gesetzliche Erbfolge? Gibt es rechnerische Unterschiede?
- Gründe für Streit analysieren: Geht es wirklich um die Erbquote oder um Prinzipien, Gefühle, Formfehler oder Zweifel an der Testierfähigkeit?
- Beweise sichern: Haben Sie konkrete Beweise für Zweifel an der Gültigkeit des Testaments (z. B. ärztliche Unterlagen zur Testierfähigkeit)?
- Kosten-Nutzen-Abwägung: Stehen die potenziellen Prozesskosten in einem sinnvollen Verhältnis zum angestrebten Ziel, insbesondere wenn die Erbteile gleich bleiben?
- Anwaltlichen Rat suchen: Frühzeitig eine Kanzlei für Erbrecht konsultieren, um die Situation zu bewerten und strategisch vorzugehen.
Das vorliegende Urteil
OLG Bamberg – Az.: 2 W 5/21 – Beschluss vom 23.12.2021
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.