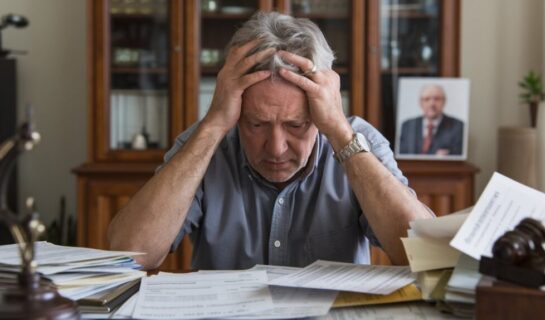Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Fall vor Gericht
- Der juristische Hintergrund: Ein Testament im Schatten der Demenz
- Der Fall: Ein spätes Testament und widersprüchliche Anhaltspunkte
- Das entscheidende Sachverständigengutachten zur Testierfähigkeit
- Die Entscheidung des Amtsgerichts Schöneberg
- Die Prüfung durch das Kammergericht Berlin
- Die endgültige Entscheidung und die Kosten
- Bedeutung der Entscheidung für Betroffene
- Die Schlüsselerkenntnisse
- Benötigen Sie Hilfe?
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Was bedeutet Testierunfähigkeit konkret und welche Voraussetzungen müssen dafür vorliegen?
- Wie wirkt sich eine Demenzerkrankung auf die Testierfähigkeit aus und welche Demenzstadien können zur Testierunfähigkeit führen?
- Welche Rolle spielt ein Sachverständigengutachten bei der Feststellung von Testierunfähigkeit und wie wird ein solches Gutachten erstellt?
- Was passiert, wenn ein Testament aufgrund von Testierunfähigkeit für ungültig erklärt wird?
- Welche Fristen sind bei der Anfechtung eines Testaments wegen Testierunfähigkeit zu beachten und welche Schritte sind dafür notwendig?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Hinweise und Tipps
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 19 W 188/21 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: KG Berlin
- Datum: 04.02.2022
- Aktenzeichen: 19 W 188/21
- Verfahrensart: Beschwerdeverfahren
- Rechtsbereiche: Erbrecht
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Beschwerdeführer (Person, die Beschwerde gegen eine frühere Gerichtsentscheidung eingelegt hat)
Worum ging es in dem Fall?
- Sachverhalt: Eine Erblasserin hatte am 24. Mai 2019 ein Testament erstellt. Später kamen Zweifel an ihrer geistigen Verfassung zu diesem Zeitpunkt auf. Ein Sachverständiger und frühere ärztliche Untersuchungen stellten fest, dass sie wegen einer fortgeschrittenen Demenzerkrankung nicht mehr in der Lage war, einen freien Willen zu bilden (Testierunfähigkeit). Das Amtsgericht Schöneberg hatte dazu bereits am 13. Oktober 2021 eine Entscheidung getroffen, gegen die der Beschwerdeführer vorging.
- Kern des Rechtsstreits: War die Erblasserin am 24. Mai 2019 aufgrund ihrer Demenzerkrankung testierfähig, also in der Lage, ein gültiges Testament zu errichten?
Was wurde entschieden?
- Entscheidung: Die Beschwerde gegen die Entscheidung des Amtsgerichts Schöneberg vom 13. Oktober 2021 wurde zurückgewiesen.
- Begründung: Das Gericht stützte seine Entscheidung maßgeblich auf ein Sachverständigengutachten. Dieses kam zum Schluss, dass die Erblasserin bei der Erstellung des Testaments testierunfähig war. Das Gericht betonte, dass auch wenn Demenzkranke nach außen hin manchmal normal wirken und Gespräche führen können, dies die zugrundeliegende Erkrankung und die fehlende Fähigkeit zur freien Willensbildung nicht ausschließt. Fachärztliche Untersuchungen kurz vor der Testamentserstellung bestätigten eine schwere Demenz mit massiven Beeinträchtigungen des Denkens, der Orientierung und des Gedächtnisses.
- Folgen: Der Beschwerdeführer muss die Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen. Das Testament vom 24. Mai 2019 ist als unwirksam anzusehen, da die Erblasserin zum Zeitpunkt der Erstellung nicht testierfähig war.
Der Fall vor Gericht
Der juristische Hintergrund: Ein Testament im Schatten der Demenz

Das Kammergericht (KG) Berlin hat in einem Beschluss vom 4. Februar 2022 (Az.: 19 W 188/21) die Beschwerde gegen eine Entscheidung des Amtsgerichts Schöneberg zurückgewiesen. Kern des Verfahrens war die Frage, ob eine an Demenz erkrankte Frau zum Zeitpunkt der Errichtung eines notariellen Testaments noch testierfähig war. Das Gericht bestätigte die Testierunfähigkeit der Erblasserin und damit die Ungültigkeit des Testaments.
Der Fall: Ein spätes Testament und widersprüchliche Anhaltspunkte
Die verwitwete und kinderlose Erblasserin, Frau Gxxx Cxxx Mxxx, hatte am 24. Mai 2019 ein Notarielles Testament errichtet. In diesem setzte sie ihren Pfleger, den Beteiligten zu 2, als Alleinerben ein und widerrief damit frühere Verfügungen. Brisant war dies, da bereits am 16. April 2019 für Frau Mxxx eine rechtliche Betreuung eingerichtet worden war. Grund hierfür war eine fortschreitende Demenzerkrankung.
Die Vorgeschichte: Medizinische Diagnosen und Betreuung
Ein fachärztliches Gutachten im Vorfeld der Betreuungseinrichtung hatte ergeben, dass Frau Mxxx unter einem dementiellen Syndrom litt. Dies führte zu massiven Beeinträchtigungen der Orientierung, der Auffassungsgabe, des Gedächtnisses sowie der kognitiv-intellektuellen Funktionen. Laut Gutachten konnte sie einfache Alltagssachverhalte nicht mehr überblicken. Zudem wurden Wahnvorstellungen und Ängste beschrieben. Die Geschäftsfähigkeit wurde verneint.
Der Erbscheinsantrag und die Zweifel des Nachlassgerichts
Nach dem Tod von Frau Mxxx im Jahr 2020 beantragte der im Testament vom Mai 2019 bedachte Pfleger beim Nachlassgericht die Erteilung eines Alleinerbscheins. Aufgrund der bekannten Vorgeschichte und der kurz vor der Testamentserrichtung festgestellten gravierenden kognitiven Defizite beauftragte das Nachlassgericht einen Sachverständigen. Dieser sollte klären, ob die Erblasserin am 24. Mai 2019 überhaupt noch testierfähig war.
Das entscheidende Sachverständigengutachten zur Testierfähigkeit
Der gerichtlich bestellte Sachverständige kam in seinem Gutachten vom 14. August 2021 zu einem eindeutigen Ergebnis. Er diagnostizierte bei der Erblasserin zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung eine mittelschwere senile Demenz vom Alzheimer-Typ. Aufgrund schwerer Gedächtnisstörungen, einer gestörten Auffassungsfähigkeit und einer aufgehobenen Kritik- und Urteilsfähigkeit sei sie nicht mehr in der Lage gewesen, die Bedeutung ihrer Willenserklärung einzusehen und entsprechend zu handeln.
Die Beweislage: Fundierte Diagnosen gegen den äußeren Anschein
Der Sachverständige stützte seine Einschätzung auf eine solide Datenlage. Insbesondere das psychiatrische Gutachten aus dem Betreuungsverfahren, das nur wenige Wochen vor der Testamentserrichtung erstellt wurde, war von großer Bedeutung. Es attestierte bereits damals massive kognitive Defizite und schloss eine freie Willensbildung aus. Zusätzliche ärztliche Befunde aus früheren Krankenhausaufenthalten untermauerten diese Diagnose.
Die Entscheidung des Amtsgerichts Schöneberg
Basierend auf dem überzeugenden Sachverständigengutachten wies das Amtsgericht Schöneberg den Antrag des Pflegers auf Erteilung des Erbscheins mit Beschluss vom 13. Oktober 2021 zurück. Das Gericht war überzeugt, dass das Testament vom 24. Mai 2019 wegen nachgewiesener Testierunfähigkeit der Erblasserin ungültig war. Gegen diesen Beschluss legte der Pfleger Beschwerde beim Kammergericht Berlin ein.
Die Prüfung durch das Kammergericht Berlin
Das Kammergericht Berlin prüfte die Beschwerde und kam zu dem Schluss, dass sie keine Aussicht auf Erfolg hat. Der Senat schloss sich vollumfänglich der Einschätzung des Sachverständigen und der Entscheidung des Amtsgerichts an. Die Testierunfähigkeit der Erblasserin zum relevanten Zeitpunkt stehe zur Überzeugung des Gerichts fest.
Die Schwierigkeit der Beurteilung von Demenzkranken
Das Gericht betonte ausdrücklich, wie schwierig es sein kann, das tatsächliche Ausmaß einer Demenzerkrankung von außen zu erkennen. Betroffene könnten oft, insbesondere bei sporadischen Kontakten, ihre Defizite überspielen („Fassadenverhalten“). Dass die Erblasserin möglicherweise im Gespräch mit dem Notar, der Hausärztin oder Pflegekräften unauffällig wirkte, stehe daher nicht im Widerspruch zur festgestellten Testierunfähigkeit.
Gewichtung der Beweismittel: Fachärztliche Gutachten entscheidend
Entscheidend seien für das Gericht die fundierten fachärztlichen Untersuchungen und Gutachten gewesen. Diese lieferten ein klares Bild des geistigen Zustands der Erblasserin kurz vor und zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung. Demgegenüber treten subjektive Eindrücke von Laien oder auch von Berufsgeheimnisträgern wie Notaren, die nur kurzzeitig mit der Person interagieren, in den Hintergrund.
Die endgültige Entscheidung und die Kosten
Das Kammergericht wies die Beschwerde des Pflegers folgerichtig zurück. Er muss die Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen. Das Gericht legte dem Beschwerdeführer nahe, die Beschwerde aus Kostengründen zurückzunehmen, was dieser jedoch offenbar nicht tat. Das Testament vom 24. Mai 2019 ist damit endgültig als ungültig anzusehen. Es gelten frühere wirksame letztwillige Verfügungen oder die Gesetzliche Erbfolge.
Bedeutung der Entscheidung für Betroffene
Für Testierende und ihre Angehörigen
Diese Entscheidung unterstreicht die immense Bedeutung einer frühzeitigen und sorgfältigen Nachlassplanung, insbesondere bei beginnenden kognitiven Einschränkungen. Wer sichergehen will, dass sein letzter Wille anerkannt wird, sollte bei Anzeichen von Demenz nicht zögern, ärztlichen Rat einzuholen und gegebenenfalls die Testierfähigkeit zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung dokumentieren zu lassen. Umgekehrt müssen Angehörige damit rechnen, dass auch notarielle Testamente angefochten und für ungültig erklärt werden können, wenn zum Zeitpunkt der Errichtung nachweislich Testierunfähigkeit bestand.
Für Notare und Ärzte
Notare stehen vor der Herausforderung, die Testierfähigkeit bei der Beurkundung zu prüfen. Dieser Fall zeigt, dass der äußere Anschein trügen kann. Eine ärztliche Bestätigung der Testierfähigkeit kann in Zweifelsfällen sinnvoll sein. Ärzte wiederum spielen eine zentrale Rolle bei der Diagnose von Demenz und der Erstellung von Gutachten, die im Erbfall entscheidende Beweismittel darstellen können. Ihre Dokumentation ist oft ausschlaggebend.
Für potenzielle Erben und Erbstreitigkeiten
Das Urteil verdeutlicht, dass die Berufung auf ein Testament, das unter dem Einfluss einer Demenzerkrankung entstanden ist, juristisch angreifbar ist. Medizinische Gutachten sind oft der Schlüssel in Erbstreitigkeiten um die Testierfähigkeit. Wer Zweifel an der Gültigkeit eines Testaments aufgrund von Demenz hat, sollte prüfen lassen, ob entsprechende ärztliche Befunde vorliegen, die eine Testierunfähigkeit belegen könnten. Die Hürden hierfür sind jedoch hoch.
Die Schlüsselerkenntnisse
Die Entscheidung zeigt, dass bei Demenzerkrankungen die Testierunfähigkeit auch dann besteht, wenn Betroffene im Alltag noch scheinbar normale Gespräche führen können. Fachärztliche Gutachten haben bei der Beurteilung der Testierfähigkeit wesentlich mehr Gewicht als Eindrücke von Laien oder gelegentlichen Kontaktpersonen wie Notaren. Besonders bedeutsam sind zeitnahe medizinische Untersuchungen zur Testamenterstellung, da sie die tatsächliche kognitive Leistungsfähigkeit objektiv dokumentieren und nicht durch die bei Demenz häufige Fähigkeit, Gedächtnisstörungen zu verbergen, verfälscht werden.
Benötigen Sie Hilfe?
Testierunfähigkeit und die Gültigkeit von Testamenten
Bestehen Zweifel an der Testierfähigkeit einer Person zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung, etwa aufgrund einer Demenzerkrankung, kann dies weitreichende Folgen für die Gültigkeit des Testaments haben. Die Beweislast für die Testierunfähigkeit liegt in der Regel bei demjenigen, der das Testament anficht. Gerade bei Demenzerkrankungen ist die Beweisführung oft komplex und erfordert detaillierte Kenntnisse der medizinischen Sachverhalte.
Wir unterstützen Sie bei der rechtlichen Bewertung Ihrer individuellen Situation und der Prüfung der Erfolgsaussichten einer möglichen Anfechtungsklage. Unsere Expertise im Erbrecht ermöglicht es uns, auch komplizierte Sachverhalte verständlich aufzubereiten und Ihre Interessen effektiv zu vertreten. Nehmen Sie Kontakt auf, um Ihre Situation unverbindlich zu besprechen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was bedeutet Testierunfähigkeit konkret und welche Voraussetzungen müssen dafür vorliegen?
Testierunfähigkeit bedeutet, dass eine Person rechtlich nicht in der Lage ist, ein gültiges Testament zu errichten oder ein bestehendes Testament zu widerrufen. Grundsätzlich geht das Gesetz davon aus, dass jeder Mensch ab 16 Jahren testierfähig ist (§ 2229 Abs. 1 BGB). Testierunfähigkeit ist also die Ausnahme.
Welche geistigen Fähigkeiten sind für ein Testament nötig?
Um ein wirksames Testament zu erstellen, müssen Sie bestimmte geistige Fähigkeiten besitzen. Sie müssen im Wesentlichen verstehen, was Sie tun und welche Konsequenzen Ihre Entscheidung hat. Dazu gehört:
- Verständnis der Handlung: Sie müssen begreifen, dass Sie gerade eine letztwillige Verfügung treffen, also eine Regelung für Ihr Erbe nach Ihrem Tod.
- Einsicht in die Tragweite: Sie sollten sich im Klaren darüber sein, wer durch das Testament begünstigt oder benachteiligt wird und welche Auswirkungen Ihre Anordnungen haben (z.B. wer erbt, wer weniger oder nichts bekommt). Ein grober Überblick über das eigene Vermögen und die familiären Verhältnisse ist ebenfalls notwendig.
- Freie Willensbildung: Ihre Entscheidung muss auf Ihrem eigenen, freien Willen beruhen. Sie dürfen nicht durch krankhafte Störungen, Wahnvorstellungen oder die unzulässige Beeinflussung durch andere Personen daran gehindert sein, einen klaren Entschluss zu fassen und danach zu handeln.
Wann liegt Testierunfähigkeit vor?
Testierunfähigkeit liegt vor, wenn jemand aufgrund bestimmter Zustände nicht mehr die nötigen geistigen Fähigkeiten besitzt, um die Bedeutung und Tragweite eines Testaments zu verstehen und frei darüber zu entscheiden. Das Gesetz nennt hierfür konkrete Gründe (§ 2229 Abs. 4 BGB):
- Krankhafte Störung der Geistestätigkeit: Hierzu zählen schwere psychische Erkrankungen oder Wahnvorstellungen, die die Fähigkeit zur freien Willensbildung beeinträchtigen.
- Geistesschwäche: Dies bezieht sich auf angeborene oder erworbene Intelligenzminderungen erheblichen Grades.
- Bewusstseinsstörung: Gemeint sind vorübergehende Zustände, wie z.B. hohes Fieber, starker Alkoholeinfluss oder die Wirkung bestimmter Medikamente, die die geistige Klarheit trüben.
Wichtig ist: Es kommt immer auf den individuellen Zustand der Person genau zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung an. Eine allgemeine Diagnose, wie beispielsweise Demenz, führt nicht automatisch zur Testierunfähigkeit.
Wie wird Testierunfähigkeit festgestellt?
Ob jemand zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung testierunfähig war, wird oft erst nach dem Tod im Rahmen eines Erbscheinverfahrens oder eines Erbstreits vor Gericht geprüft. Die Person, die behauptet, der Erblasser sei testierunfähig gewesen, muss dies beweisen.
Gerichte stützen ihre Entscheidung dabei meist auf:
- Ärztliche Unterlagen: Befundberichte, Krankengeschichten.
- Zeugenaussagen: Von Ärzten, Pflegepersonal, Angehörigen oder dem Notar, der das Testament beurkundet hat.
- Sachverständigengutachten: In vielen Fällen wird ein psychiatrisches oder neurologisches Gutachten eingeholt, das den geistigen Zustand des Erblassers zum relevanten Zeitpunkt rückblickend beurteilt.
Testierfähigkeit bei Demenz
Eine Demenzerkrankung ist eine der häufigsten Ursachen, die zu Testierunfähigkeit führen kann, aber nicht zwangsläufig muss. Entscheidend ist immer der Schweregrad der Erkrankung und der geistige Zustand im Moment der Testamentserstellung.
Selbst bei einer fortgeschrittenen Demenz kann es „lichte Momente“ (lucida intervalla) geben, in denen die betroffene Person vorübergehend geistig klar und orientiert ist. In einem solchen Moment kann sie durchaus testierfähig sein und ein wirksames Testament errichten. Die Feststellung, ob ein solcher lichter Moment vorlag, ist im Nachhinein jedoch oft sehr schwierig.
Wie wirkt sich eine Demenzerkrankung auf die Testierfähigkeit aus und welche Demenzstadien können zur Testierunfähigkeit führen?
Eine Demenzerkrankung führt nicht automatisch dazu, dass eine Person kein wirksames Testament mehr errichten kann. Entscheidend ist immer der individuelle Zustand der Person zum Zeitpunkt der Testamentserstellung.
Was bedeutet Testierfähigkeit?
Testierfähigkeit ist die Fähigkeit, ein Testament rechtlich wirksam zu errichten, zu ändern oder aufzuheben. Nach dem Gesetz (§ 2229 Abs. 4 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) ist testierunfähig, wer wegen einer krankhaften Störung der Geistestätigkeit, wegen Geistesschwäche oder wegen Bewusstseinsstörung nicht in der Lage ist, die Bedeutung einer von ihm abgegebenen Willenserklärung einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln.
Vereinfacht gesagt, muss die Person zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung:
- Verstehen, dass sie ein Testament macht und was das bedeutet (nämlich die Verteilung ihres Vermögens nach dem Tod).
- Eine klare Vorstellung davon haben, welches Vermögen sie besitzt und wer die Personen sind, die sie bedenken oder von der Erbfolge ausschließen möchte.
- In der Lage sein, einen eigenen, freien Willen zu bilden und diesen auch zu äußern, ohne von Dritten unzulässig beeinflusst zu werden oder aufgrund der Erkrankung fremden Vorstellungen zu folgen.
Demenz und die Fähigkeit zur Testamentserrichtung
Eine Demenz beeinträchtigt verschiedene geistige Fähigkeiten, die für die Testierfähigkeit wichtig sind, wie Gedächtnis, Orientierung, Urteilsvermögen und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu verstehen.
Ob diese Beeinträchtigungen zur Testierunfähigkeit führen, hängt vom Schweregrad der Demenz und den konkreten Auswirkungen auf die oben genannten Fähigkeiten ab. Die medizinische Einteilung in Demenzstadien (leicht, mittel, schwer) gibt zwar Hinweise, ist aber juristisch nicht allein ausschlaggebend.
- Leichte Demenz: Personen mit einer leichten Demenz sind häufig noch testierfähig. Sie können oft noch verstehen, was ein Testament ist, wer ihre Angehörigen sind und was sie vererben möchten. Wichtig ist, dass sie ihre Entscheidung frei von krankheitsbedingten Wahnvorstellungen oder unzulässiger Beeinflussung treffen können.
- Mittelschwere Demenz: Hier wird die Testierfähigkeit oft fraglich oder ist nicht mehr gegeben. Die kognitiven Einschränkungen sind meist so stark, dass die Person die Tragweite ihrer Entscheidung nicht mehr vollständig überblicken oder ihren Willen nicht mehr frei und unbeeinflusst bilden kann. Das Kurzzeitgedächtnis und das Verständnis für Zusammenhänge sind oft erheblich gestört.
- Schwere Demenz: Bei einer schweren Demenz liegt in der Regel Testierunfähigkeit vor. Die Betroffenen können die Bedeutung und die Folgen eines Testaments nicht mehr erfassen, erkennen oft nahestehende Personen nicht mehr und können keinen freien Willen mehr bilden.
Entscheidend ist der Moment der Testamentserrichtung
Ganz wichtig: Für die Beurteilung der Testierfähigkeit kommt es ausschließlich auf den Zustand der Person in dem Moment an, in dem sie das Testament errichtet. Auch bei einer fortgeschrittenen Demenz kann es theoretisch „lichte Momente“ (sogenannte lucida intervalla) geben, in denen die Person kurzzeitig die erforderliche Einsichts- und Handlungsfähigkeit besitzt. Solche Momente sind in der Praxis jedoch oft schwer nachzuweisen.
Umgekehrt bedeutet eine Demenzdiagnose nicht, dass die Person ab diesem Zeitpunkt dauerhaft testierunfähig ist. Die Beurteilung ist immer eine Einzelfallentscheidung, die sich auf den konkreten Zeitpunkt der Testamentserrichtung bezieht. Im Streitfall wird die Testier(un)fähigkeit oft durch ärztliche Gutachten geklärt, die den Zustand zum relevanten Zeitpunkt rückblickend bewerten. Die Beweislast für die Testierunfähigkeit liegt bei demjenigen, der behauptet, das Testament sei aus diesem Grund ungültig.
Welche Rolle spielt ein Sachverständigengutachten bei der Feststellung von Testierunfähigkeit und wie wird ein solches Gutachten erstellt?
Ein Sachverständigengutachten spielt oft eine zentrale Rolle, wenn ein Gericht klären muss, ob eine Person zum Zeitpunkt der Erstellung ihres Testaments testierfähig war. Testierfähigkeit bedeutet, dass jemand versteht, was ein Testament ist, welche Folgen es hat und dass er frei entscheiden kann, wer sein Erbe erhalten soll. Gerade bei Erkrankungen wie Demenz können Zweifel an dieser Fähigkeit aufkommen.
Die Bedeutung des Gutachtens im Gerichtsverfahren
Gerichte verfügen in der Regel nicht über das notwendige medizinische Fachwissen, um selbst beurteilen zu können, ob eine Person aufgrund einer Erkrankung wie Demenz testierunfähig war. Deshalb beauftragen sie häufig einen unabhängigen Sachverständigen.
Das Gutachten dient dem Gericht als wichtiges Beweismittel. Es liefert eine fachliche Einschätzung dazu, ob die Person zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung in der Lage war, die Bedeutung und die Tragweite ihrer Entscheidung zu verstehen und ihren Willen frei zu bilden. Es hilft dem Gericht also bei der schwierigen Frage, ob das Testament gültig ist oder nicht.
Wer erstellt das Gutachten?
Das Gutachten wird von einem medizinischen Sachverständigen erstellt. Das Gericht wählt hierfür in der Regel einen unabhängigen Experten aus, um eine neutrale Beurteilung sicherzustellen.
Die erforderliche Qualifikation ist hoch: Meist handelt es sich um Fachärzte für Psychiatrie, Neurologie oder Geriatrie. Diese Ärzte müssen besondere Erfahrung in der Beurteilung der geistigen Leistungsfähigkeit von Menschen haben, insbesondere im Zusammenhang mit altersbedingten Erkrankungen wie Demenz und deren Einfluss auf die Geschäfts- und Testierfähigkeit.
Wie entsteht ein solches Gutachten?
Der Sachverständige trägt sorgfältig alle verfügbaren Informationen zusammen, um sich ein möglichst genaues Bild vom Zustand der Person zum Zeitpunkt der Testamentserstellung machen zu können. Dieser Prozess umfasst typischerweise folgende Schritte:
- Sichtung der medizinischen Unterlagen: Der Gutachter analysiert alle relevanten Krankenakten, Arztbriefe, Befunde, Medikamentenpläne und Pflegeunterlagen aus dem relevanten Zeitraum. Er sucht nach Diagnosen (z.B. Demenz), Symptomen und Behandlungen, die die geistige Klarheit beeinflusst haben könnten.
- Auswertung weiterer Informationen: Auch Aussagen von behandelnden Ärzten, Pflegekräften, Betreuern oder Angehörigen können berücksichtigt werden, wenn sie dem Gericht vorliegen. Diese können Hinweise auf das Verhalten und die geistige Verfassung der Person geben.
- Untersuchung der Person (wenn möglich): Lebt die betreffende Person noch, kann der Sachverständige sie persönlich untersuchen und spezielle Tests durchführen, um die geistigen Fähigkeiten einzuschätzen.
- Begutachtung nach dem Tod (retrospektiv): Ist die Person bereits verstorben, muss der Gutachter die Testierfähigkeit rückblickend (retrospektiv) beurteilen. Dies geschieht ausschließlich auf Basis der vorhandenen Akten und Zeugenaussagen. Eine solche Beurteilung ist oft komplexer.
Im Gutachten fasst der Sachverständige seine Erkenntnisse zusammen und gibt eine begründete Einschätzung ab, ob zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung Testierfähigkeit vorlag oder nicht. Dabei erklärt er nachvollziehbar, wie er zu seiner Schlussfolgerung gekommen ist.
Das Gericht prüft das Gutachten und bezieht es in seine Gesamtbewertung aller Beweise mit ein. Es ist zwar ein wichtiges, aber nicht das alleinige Entscheidungskriterium.
Was passiert, wenn ein Testament aufgrund von Testierunfähigkeit für ungültig erklärt wird?
Wird gerichtlich festgestellt, dass eine Person zum Zeitpunkt der Errichtung ihres Testaments testierunfähig war (also nicht die nötige geistige Fähigkeit besaß, ein Testament wirksam zu erstellen, beispielsweise aufgrund einer fortgeschrittenen Demenz), dann ist dieses Testament ungültig. Es entfaltet keine rechtliche Wirkung. Die darin festgelegten Wünsche des Verstorbenen zur Verteilung seines Nachlasses werden nicht berücksichtigt.
Folge: Das Testament ist unwirksam
Ein für ungültig erklärtes Testament ist so zu behandeln, als hätte es nie existiert. Das bedeutet, die Personen, die in diesem Testament als Erben eingesetzt oder mit einem Vermächtnis bedacht wurden, leiten daraus keine Ansprüche ab, es sei denn, sie sind auch nach der dann geltenden Erbfolge erbberechtigt.
Was gilt stattdessen für die Erbfolge?
Wenn das Testament für ungültig erklärt wird, muss geklärt werden, wer stattdessen erbt. Hier gibt es zwei Möglichkeiten:
- Ein früheres, gültiges Testament gilt: Es wird geprüft, ob der Verstorbene vor dem ungültigen Testament ein früheres Testament verfasst hat. Wenn dieses frühere Testament wirksam errichtet wurde und nicht widerrufen wurde, dann gilt dieses frühere Testament. Die Erbfolge richtet sich dann nach den Anordnungen in diesem älteren Dokument.
- Die gesetzliche Erbfolge tritt ein: Gibt es kein früheres, gültiges Testament, oder wurde auch dieses widerrufen, dann kommt die gesetzliche Erbfolge zur Anwendung. Das bedeutet, der Nachlass wird nach den Regeln verteilt, die das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vorsieht. Wer nach dem Gesetz erbt, hängt vom Verwandtschaftsverhältnis zum Verstorbenen ab. In der Regel erben der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner sowie die nächsten Verwandten (Kinder, Enkel, Eltern, Geschwister etc.) in einer bestimmten Reihenfolge und zu bestimmten Anteilen.
Für Sie bedeutet das: Die Ungültigkeit eines Testaments wegen Testierunfähigkeit kann dazu führen, dass der Nachlass völlig anders verteilt wird, als es im ungültigen Testament vorgesehen war. Es erben dann entweder die Personen, die in einem früheren gültigen Testament bedacht wurden, oder die gesetzlichen Erben.
Welche Fristen sind bei der Anfechtung eines Testaments wegen Testierunfähigkeit zu beachten und welche Schritte sind dafür notwendig?
Wenn Zweifel daran bestehen, ob der Verstorbene zum Zeitpunkt der Errichtung seines Testaments noch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war (also testierfähig war, § 2229 Abs. 4 BGB), kann das Testament unter Umständen angefochten werden. Dies ist beispielsweise relevant, wenn der Erblasser an einer fortgeschrittenen Demenz litt. Für eine solche Anfechtung gelten bestimmte Fristen und Abläufe.
Die Anfechtungsfrist: Ein Jahr ab Kenntnis
Die wichtigste Frist für die Anfechtung eines Testaments wegen Testierunfähigkeit beträgt ein Jahr. Diese Frist beginnt nicht automatisch mit dem Tod des Erblassers. Sie startet erst ab dem Zeitpunkt, an dem die Person, die anfechten möchte, von der möglichen Testierunfähigkeit als Anfechtungsgrund erfahren hat (§ 2082 Abs. 1 und 2 BGB).
- Beispiel: Sie erfahren erst sechs Monate nach dem Tod des Erblassers durch ein ärztliches Attest von dessen fortgeschrittener Demenz zum Zeitpunkt der Testamentserstellung. Die Jahresfrist zur Anfechtung beginnt dann erst ab diesem Moment zu laufen.
Wichtig zu wissen: Unabhängig davon, wann man von der Testierunfähigkeit erfährt, ist eine Anfechtung spätestens 30 Jahre nach dem Erbfall ausgeschlossen (§ 2082 Abs. 3 BGB). Diese lange Frist spielt in Fällen der Testierunfähigkeit jedoch seltener eine Rolle, da die Umstände meist früher bekannt werden. Versäumen Sie die Jahresfrist ab Kenntnis, geht das Recht zur Anfechtung verloren. Untätigkeit kann also zum Verlust Ihrer möglichen Rechte führen.
Schritte zur Anfechtung: Erklärung und Begründung
Eine Anfechtung erfolgt nicht automatisch. Sie müssen aktiv werden:
- Anfechtungserklärung: Die Anfechtung muss ausdrücklich erklärt werden. Diese Erklärung richten Sie in der Regel an das zuständige Nachlassgericht (§ 2081 Abs. 1 BGB). Das Nachlassgericht ist meist das Amtsgericht am letzten Wohnsitz des Verstorbenen. Die Erklärung kann dort zu Protokoll gegeben oder schriftlich eingereicht werden. Eine bestimmte Form ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, eine schriftliche Erklärung ist aber aus Beweisgründen sinnvoll.
- Anfechtungsberechtigung: Anfechten kann nur, wer durch die Aufhebung des Testaments einen Vorteil hätte (§ 2080 BGB). Das sind typischerweise die gesetzlichen Erben (wenn sie durch das Testament benachteiligt wurden) oder Personen, die in einem früheren, gültigen Testament als Erben eingesetzt waren.
- Anfechtungsgrund nennen: In der Erklärung muss klar angegeben werden, warum das Testament angefochten wird – in diesem Fall wegen der vermuteten Testierunfähigkeit des Erblassers zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung.
Nachweis der Testierunfähigkeit: Die Herausforderung
Der entscheidende Punkt bei der Anfechtung wegen Testierunfähigkeit ist der Nachweis, dass der Erblasser zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung tatsächlich nicht mehr testierfähig war. Das bedeutet, er konnte aufgrund seiner geistigen Verfassung (z.B. wegen Demenz) die Bedeutung seiner Entscheidung nicht mehr verstehen oder war nicht mehr in der Lage, frei von krankheitsbedingten Einflüssen zu handeln.
- Beweislast: Die Person, die das Testament anficht, muss die Testierunfähigkeit darlegen und beweisen. Sie muss also konkrete Tatsachen und Umstände vortragen, die auf die Testierunfähigkeit schließen lassen. Das bloße Behaupten reicht nicht aus.
- Mögliche Beweismittel: Hierzu können beispielsweise ärztliche Unterlagen (Gutachten, Atteste, Patientenakten), Zeugenaussagen von Ärzten, Pflegepersonal oder Bekannten, oder auch Schriftstücke des Erblassers dienen, die auf eine geistige Beeinträchtigung hindeuten.
- Zeitpunkt: Entscheidend ist immer der genaue Zustand des Erblassers zum Zeitpunkt der Testamentserstellung. Gerade bei Krankheiten wie Demenz, die oft schleichend verlaufen und Schwankungen unterliegen können („lichte Momente“), kann dieser Nachweis komplex sein.
Das Nachlassgericht prüft die vorgebrachten Gründe und Beweise im Rahmen des Verfahrens, beispielsweise bei der Entscheidung über die Erteilung eines Erbscheins. Stellt das Gericht die Testierunfähigkeit fest, ist das Testament (oder der betreffende Teil davon) unwirksam. Dies hätte zur Folge, dass entweder ein früheres, gültiges Testament zur Anwendung kommt oder die gesetzliche Erbfolge eintritt.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung ersetzen kann. Haben Sie konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir beraten Sie gerne.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Testierfähigkeit
Testierfähigkeit ist die geistige Fähigkeit einer Person, ein wirksames Testament zu errichten oder einen Erbvertrag zu schließen. Entscheidend ist, ob die Person zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung in der Lage war, die Bedeutung und die Tragweite ihrer Entscheidung zu verstehen (§ 2229 Abs. 4 BGB regelt die Testierunfähigkeit). Sie muss erfassen können, wer durch das Testament begünstigt oder benachteiligt wird und welche Auswirkungen dies auf die Erbfolge hat. Im vorliegenden Fall wurde geprüft, ob Frau Mxxx trotz ihrer Demenz noch diese geistige Klarheit besaß, was das Gericht verneinte.
Beispiel: Ein älterer Herr, der zwar vergesslich ist, aber genau weiß, was ein Testament ist, wem er sein Haus vererben möchte und dass seine anderen Kinder dann leer ausgehen, gilt als testierfähig.
Testierunfähigkeit
Testierunfähigkeit liegt vor, wenn eine Person aufgrund einer krankhaften Störung der Geistestätigkeit, Geistesschwäche oder Bewusstseinsstörung nicht in der Lage ist, die Bedeutung einer von ihr abgegebenen Willenserklärung einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln (§ 2229 Abs. 4 BGB). Dies war laut Gericht bei Frau Mxxx zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung am 24. Mai 2019 der Fall, bedingt durch ihre mittelschwere Demenz. Ein wegen Testierunfähigkeit errichtetes Testament ist von Anfang an unwirksam. Die Beweislast für die Testierunfähigkeit liegt bei demjenigen, der sich darauf beruft und die Gültigkeit des Testaments anzweifelt.
Notarielles Testament
Ein notarielles Testament ist eine Form der letztwilligen Verfügung, die vor einem Notar erklärt und von diesem beurkundet wird (§ 2231 Nr. 1, § 2232 BGB). Der Notar berät die testierende Person, formuliert den Willen juristisch korrekt und soll die Identität sowie die Testierfähigkeit prüfen – zumindest nach seinem persönlichen Eindruck. Wegen dieser Förmlichkeiten hat ein notarielles Testament grundsätzlich eine hohe Beweiskraft und ersetzt später in der Regel den ansonsten erforderlichen Erbschein. Im Fall von Frau Mxxx wurde diese grundsätzliche Annahme der Gültigkeit jedoch durch den gerichtlich eingeholten Sachverständigenbeweis ihrer Testierunfähigkeit widerlegt.
Willenserklärung
Eine Willenserklärung ist die Äußerung einer Person, die bewusst darauf abzielt, eine bestimmte rechtliche Folge herbeizuführen. Sie ist ein zentraler Baustein für viele Rechtsgeschäfte wie Verträge oder eben Testamente (die als einseitige, nicht empfangsbedürftige Willenserklärung gelten). Damit eine Willenserklärung gültig ist, muss der Erklärende in der Regel geschäftsfähig bzw. – wie hier im Erbrecht – testierfähig sein. Im Fall von Frau Mxxx war entscheidend, dass sie laut Gutachten nicht mehr die Bedeutung ihrer Willenserklärung (also ihres Testaments) einsehen und deren Konsequenzen überblicken konnte.
Beispiel: Wenn Sie im Supermarkt Waren auf das Band legen und bezahlen, geben Sie durch schlüssiges Verhalten eine Willenserklärung zum Abschluss eines Kaufvertrags ab. Das Errichten eines Testaments ist ebenfalls eine Willenserklärung, wenn auch eine sehr formbedürftige.
Gesetzliche Erbfolge
Die gesetzliche Erbfolge tritt ein, wenn kein gültiges Testament oder kein Erbvertrag vorhanden ist, oder wenn diese – wie im Fall von Frau Mxxx – unwirksam sind. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) legt dann fest, wer erbt, basierend auf dem Verwandtschaftsgrad zum Erblasser (§§ 1924 ff. BGB). Geerbt wird nach Ordnungen: Zuerst erben die Abkömmlinge (Kinder, Enkel) und der Ehegatte, dann Eltern und deren Abkömmlinge (Geschwister des Erblassers), dann Großeltern und deren Abkömmlinge usw. Da das Testament von Frau Mxxx ungültig ist und sie kinderlos war, erben ihre nächsten Verwandten nach dieser gesetzlichen Rangfolge (sofern keine frühere, gültige Verfügung existiert).
Hinweise und Tipps
Praxistipps für Erben und potenzielle Erben zum Thema Gültigkeit eines Testaments bei Demenz
Ein Erbfall steht an, und es gibt ein Testament. Doch manchmal bestehen Zweifel, ob der Verstorbene zum Zeitpunkt der Testamentserstellung aufgrund einer Demenzerkrankung überhaupt noch wusste, was er tat. Solche Zweifel können dazu führen, dass die Gültigkeit des Testaments gerichtlich überprüft wird.
Hinweis: Diese Praxistipps stellen keine Rechtsberatung dar. Sie ersetzen keine individuelle Prüfung durch eine qualifizierte Kanzlei. Jeder Einzelfall kann Besonderheiten aufweisen, die eine abweichende Einschätzung erfordern.
Tipp 1: Ärztliche Unterlagen sind zentral
Wenn Zweifel an der Testierfähigkeit des Erblassers wegen Demenz bestehen, sind ärztliche Berichte und Gutachten entscheidend. Sammeln Sie alle verfügbaren medizinischen Dokumente (Arztbriefe, Pflegeberichte, Gutachten), die den geistigen Zustand des Erblassers zeitnah zur Testamentserstellung dokumentieren. Diese Unterlagen sind oft die wichtigste Grundlage für die gerichtliche Beurteilung.
⚠️ ACHTUNG: Ältere Diagnosen oder allgemeine Feststellungen reichen oft nicht aus. Es kommt auf den konkreten Zustand zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung an.
Tipp 2: Nicht vom äußeren Eindruck täuschen lassen
Demenzkranke können manchmal nach außen hin orientiert wirken und einfache Gespräche führen („fassadenhafte Normalität“). Dies bedeutet jedoch nicht automatisch, dass sie testierfähig waren. Gerichte stützen sich auf medizinische Fakten zur Gehirnleistung (Denken, Orientierung, Gedächtnis), nicht nur auf den flüchtigen Eindruck von Zeugen.
⚠️ ACHTUNG: Aussagen wie „Er wirkte an dem Tag ganz klar“ haben oft wenig Gewicht, wenn ärztliche Befunde eine fortgeschrittene Demenz belegen.
Tipp 3: Sachverständigengutachten haben hohes Gewicht
In Gerichtsverfahren zur Testierfähigkeit wird meist ein neurologisches oder psychiatrisches Sachverständigengutachten eingeholt. Dieses Gutachten analysiert die medizinischen Befunde und bewertet die Fähigkeit zur freien Willensbildung zum relevanten Zeitpunkt. Die Einschätzung des Gutachters ist oft ausschlaggebend für die Gerichtsentscheidung.
Tipp 4: Folgen der Testierunfähigkeit bedenken
Stellt ein Gericht fest, dass der Erblasser bei Testamentserrichtung testierunfähig war, ist das Testament unwirksam. Das bedeutet:
- Es gilt die gesetzliche Erbfolge, als ob es kein Testament gäbe.
- Oder: Ein früheres, zu einem Zeitpunkt der Testierfähigkeit errichtetes Testament wird wirksam.
Prüfen Sie, welche Erbfolge (gesetzlich oder durch ein früheres Testament) eintreten würde, falls das aktuelle Testament für ungültig erklärt wird.
Tipp 5: Kostenrisiko bei Streitigkeiten beachten
Gerichtsverfahren über die Gültigkeit eines Testaments können komplex und teuer sein (Gerichtsgebühren, Anwaltskosten, Gutachterkosten). Derjenige, der im Verfahren unterliegt, muss in der Regel die gesamten Kosten tragen. Wägen Sie Chancen, Risiken und Kosten sorgfältig ab, bevor Sie einen Rechtsstreit beginnen oder fortführen.
Weitere Fallstricke oder Besonderheiten?
Der entscheidende Punkt ist immer die Fähigkeit zur freien Willensbildung zum Zeitpunkt der Testamentserstellung. Selbst wenn der Erblasser noch geschäftsfähig für alltägliche Dinge war, kann die komplexere Anforderung der Testierfähigkeit gefehlt haben. Die Beweislast für die Testierunfähigkeit liegt in der Regel bei demjenigen, der sich darauf beruft.
✅ Checkliste: Testament und Demenz
- Zeitpunkt prüfen: Wann genau wurde das Testament erstellt?
- Medizinische Beweise sichern: Gibt es Arztberichte, Gutachten oder Pflegeunterlagen aus der Zeit um die Testamentserstellung?
- Schwere der Demenz klären: Lag eine leichte oder bereits eine schwere Demenz mit Orientierungs-, Denk- und Gedächtnisstörungen vor?
- Folgen abschätzen: Was passiert, wenn das Testament ungültig ist (gesetzliche Erbfolge, früheres Testament)?
- Kostenrisiko bewerten: Stehen die potenziellen Kosten eines Rechtsstreits im Verhältnis zum erwarteten Ergebnis?
Das vorliegende Urteil
KG Berlin – Az.: 19 W 188/21 – Beschluss vom 04.02.2022
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.