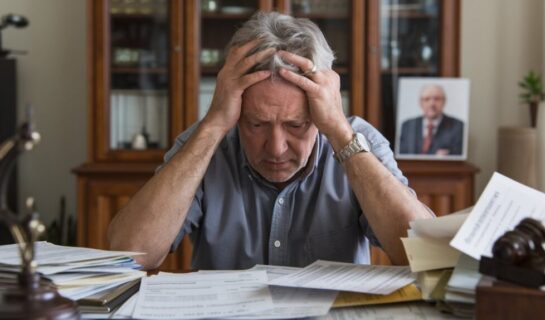Testamentswiderruf durch Betreuer: Gericht bestellt Ergänzungsbetreuer
Das Amtsgericht Altötting hat im Fall XVII 152/15 entschieden, dass zur wirksamen Entgegennahme des Widerrufs eines gemeinschaftlichen Testaments die Bestellung einer Ergänzungsbetreuerin notwendig ist, wenn einer der Testierenden, hier die Ehefrau, geschäftsunfähig ist. Dies stellt sicher, dass der Widerruf rechtlich anerkannt und der Schutz beider Parteien gewährleistet wird. Die Entscheidung betont die Bedeutung der rechtlichen Betreuung in Fällen, wo Geschäftsunfähigkeit die Ausübung von Rechten beeinträchtigt.
Weiter zum vorliegenden Urteil Az.: XVII 152/15 >>>
✔ Das Wichtigste in Kürze
Die zentralen Punkte aus dem Urteil:
- Bestellung einer Ergänzungsbetreuerin zur Entgegennahme des Widerrufs eines gemeinschaftlichen Testaments aufgrund der Geschäftsunfähigkeit der Ehefrau.
- Der Widerruf ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung und wird erst wirksam, wenn sie dem anderen Teil zugeht.
- Notwendigkeit der Bestellung eines anderen Betreuers, wenn der widerrufende Testierende gleichzeitig als Betreuer fungiert.
- Feststellung der Geschäftsunfähigkeit der Ehefrau basierend auf einem psychiatrischen Gutachten.
- Rechtliche Betreuung als Vertretungsregelung, die die Handlungsfähigkeit im Rechtsverkehr bei Geschäftsunfähigkeit sicherstellt.
- Rechtssicherheit für beide Ehepartner durch die Betreuerbestellung und die Möglichkeit des Widerrufs.
- Betreuungsinteresse besteht auch im Interesse des geschäftsunfähigen Ehepartners.
- Auswahl der Betreuerin basiert auf einem Vorschlag der Betreuungsbehörde, wobei Interessenkonflikte vermieden werden sollen.
Übersicht
Rechtliche Betreuung im Erbrecht: Ein entscheidender Aspekt
Das Erbrecht konfrontiert uns oft mit komplexen und sensiblen Situationen, insbesondere wenn es um die Ausübung von Rechten durch geschäftsunfähige Personen geht. Ein zentrales Element in solchen Fällen ist die rechtliche Betreuung, die eine entscheidende Rolle spielt, um die Interessen aller Beteiligten zu wahren. Im Fokus steht dabei oft der Widerruf eines gemeinschaftlichen Testaments, eine Handlung, die rechtlich anspruchsvoll und von hoher Bedeutung ist.
Diese Thematik wirft wichtige Fragen auf: Wie wird die rechtliche Handlungsfähigkeit bei Geschäftsunfähigkeit sichergestellt? Welche Rolle spielt die Betreuerbestellung im Kontext des Erbrechts, insbesondere wenn es um die Entgegennahme eines solchen Widerrufs geht? Der folgende Text beleuchtet ein konkretes Urteil, das Licht auf diese Fragen wirft und zeigt, wie das Gericht in einem spezifischen Fall entschieden hat. Tauchen Sie ein in die Details dieses faszinierenden Rechtsbereichs, die nicht nur für Juristen, sondern für jeden, der mit Fragen des Erbrechts konfrontiert ist, von Interesse sein können.
Die Rolle der rechtlichen Betreuung bei Testament-Widerruf
In einem bemerkenswerten Fall vor dem Amtsgericht Altötting, Aktenzeichen XVII 152/15, wurde am 08.08.2023 ein Beschluss gefasst, der die rechtliche Betreuung zur Entgegennahme des Widerrufs eines gemeinschaftlichen Testaments thematisiert. Im Zentrum dieses Falls stand die Notwendigkeit, eine Ergänzungsbetreuerin zu bestellen, um den rechtlich komplexen Prozess des Widerrufs eines gemeinschaftlichen Testaments zu ermöglichen. Die Besonderheit des Falles ergab sich aus der Geschäftsunfähigkeit einer der testierenden Personen, wodurch die Bestellung einer rechtlichen Betreuung erforderlich wurde. Diese Konstellation trat auf, als der Ehemann der betreuten Person, der zugleich ihr Betreuer war, den Wunsch äußerte, das gemeinschaftliche Testament zu widerrufen.
Die Herausforderung der Geschäftsunfähigkeit im Erbrecht
Das Gericht stützte sich auf ein psychiatrisches Gutachten vom 30.03.2022, welches die Geschäftsunfähigkeit der Ehefrau bestätigte. Die Frau litt an einem anhaltenden hirnorganischen Psychosyndrom mit mnestischen und kognitiven Funktionsstörungen, die auf ein vorbekanntes Schädelhirntrauma zurückzuführen waren. Die Sachlage wurde bei einer gerichtlichen Anhörung am 04.08.2023 vor Ort bestätigt. Aufgrund dieser Geschäftsunfähigkeit war es notwendig, dass der Widerruf des Testaments gegenüber einem rechtlichen Vertreter erklärt wird. Dies begründet die Betreuerbestellung im speziellen Kontext des Widerrufs eines gemeinschaftlichen Testaments, eine empfangsbedürftige Willenserklärung gemäß § 2296 BGB.
Juristische Feinheiten im Umgang mit Testament-Widerruf
Die rechtliche Betreuung in diesem Fall war besonders, da sie im Drittinteresse begründet war. Normalerweise dient die Betreuung dem Interesse des Betreuten. Hier jedoch stellte die Betreuung die einzige Möglichkeit dar, die Rechte des Ehemanns gegenüber der geschäftsunfähigen Ehefrau zu wahren. Diese Situation warf eine rechtliche Herausforderung auf, da sie die Frage aufwarf, ob das Gericht verpflichtet ist, einen Betreuer zum Zweck der Entgegennahme einer Widerrufserklärung zu bestellen. Das Gericht bestätigte diese Verpflichtung und wies darauf hin, dass ohne die Betreuerbestellung das Widerrufsrecht des Ehemanns faktisch genommen wäre. Ferner erklärte das Gericht, dass die rechtliche Betreuung weiterhin als Vertretungsregelung ausgestaltet ist und die rechtliche Handlungsfähigkeit im Rechtsverkehr bei Geschäftsunfähigen sicherstellt.
Gerichtsentscheid: Bestellung einer Ergänzungsbetreuerin
Das Gericht folgte dem Vorschlag der Betreuungsbehörde und bestellte eine Ergänzungsbetreuerin für die Entgegennahme des Widerrufs. Diese Entscheidung wurde getroffen, um jeglichen Interessenkonflikt zu vermeiden, insbesondere da der Ehemann in seiner Doppelrolle als Betreuer und Testierender rechtlich verhindert war. Die Entscheidung des Gerichts unterstreicht die Bedeutung der rechtlichen Betreuung in Fällen von Geschäftsunfähigkeit, insbesondere im Hinblick auf erbrechtliche Angelegenheiten und die Wahrung der Rechte aller Beteiligten. Mit diesem Urteil wird deutlich, dass im Erbrecht auch die Interessen von geschäftsunfähigen Personen angemessen berücksichtigt und geschützt werden müssen.
Insgesamt zeigt dieser Fall die Komplexität und Bedeutung der rechtlichen Betreuung im Kontext des Erbrechts auf und verdeutlicht die Notwendigkeit einer umsichtigen rechtlichen Vertretung in Fällen von Geschäftsunfähigkeit.
✔ Wichtige Begriffe kurz erklärt
Wie wird der Widerruf eines gemeinschaftlichen Testaments rechtlich gehandhabt?
Der Widerruf eines gemeinschaftlichen Testaments in Deutschland hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel den beteiligten Personen, der Art der Verfügungen und den Umständen des Falls. Im Folgenden werden die Voraussetzungen, Form, Fristen und Folgen des Widerrufs eines gemeinschaftlichen Testaments erläutert.
- Voraussetzungen: Grundsätzlich können Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner während ihrer beider Lebzeiten ein gemeinschaftliches Testament widerrufen. Allerdings gelten für wechselbezügliche Verfügungen (Verfügungen, die voneinander abhängig sind) besondere Regelungen.
- Form: Der Widerruf eines gemeinschaftlichen Testaments muss in bestimmten Fällen notariell beurkundet werden. Bei wechselbezüglichen Verfügungen ist eine notariell beurkundete Widerrufserklärung erforderlich, die dem anderen Ehegatten oder Lebenspartner zugestellt werden muss.
- Fristen: Es gibt keine allgemeinen Fristen für den Widerruf eines gemeinschaftlichen Testaments. Allerdings kann die Anfechtung eines gemeinschaftlichen Testaments nur innerhalb eines Jahres erfolgen, nachdem der überlebende Ehegatte vom Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat.
- Folgen: Der Widerruf eines gemeinschaftlichen Testaments kann verschiedene Folgen haben, abhängig von den beteiligten Personen und den Umständen des Falls. Wenn ein gemeinschaftliches Testament widerrufen wird, verlieren die darin enthaltenen Verfügungen ihre Wirksamkeit. Bei wechselbezüglichen Verfügungen führt der Widerruf einer Verfügung zur Unwirksamkeit der anderen Verfügung. Nach dem Tod eines Ehegatten erlischt das Widerrufsrecht des überlebenden Ehegatten bezüglich des gemeinschaftlichen Testaments.
Es ist ratsam, sich bei Fragen zum Widerruf eines gemeinschaftlichen Testaments an einen Fachanwalt für Erbrecht zu wenden, um sicherzustellen, dass alle rechtlichen Anforderungen erfüllt sind und die gewünschten Ergebnisse erzielt werden.
Welche Rolle spielt eine Ergänzungsbetreuerin bei der Entgegennahme eines Testament-Widerrufs?
Eine Ergänzungsbetreuerin spielt eine entscheidende Rolle bei der Entgegennahme eines Testament-Widerrufs, insbesondere wenn der Widerrufende selbst Betreuer seines geschäftsunfähigen Ehepartners ist. In diesem Fall muss ein Ergänzungsbetreuer bestellt werden, um den Widerruf entgegenzunehmen.
Die Bestellung eines Ergänzungsbetreuers ist gemäß § 1899 Abs. 4 BGB erforderlich, wenn eine Verhinderung des Betreuers konkret zu besorgen ist. Wenn der widerrufende Ehegatte zugleich zum Betreuer des anderen Ehegatten bestellt ist, besteht wahrscheinlich ein Vertretungsausschluss, da die Empfangnahme der Widerrufserklärung nicht als lediglich rechtlich vorteilhaft angesehen werden kann. Daher muss für die Empfangnahme des Widerrufs ein Ergänzungsbetreuer nach § 1899 Abs. 4 BGB bestellt werden.
Die Geschäftsunfähigkeit nimmt nicht nur die Fähigkeit, Erklärungen wirksam abzugeben, sondern auch die Fähigkeit, Erklärungen mit Wirkung für und gegen sich zu empfangen. Ohne Betreuung scheitert der Zugang des Testamentswiderrufs.
Es ist auch zu erwähnen, dass ein Widerruf eines gemeinschaftlichen Testaments auch gegenüber dem Betreuer erklärt werden kann, wenn der andere, nicht widerrufende Ehegatte geschäftsunfähig ist und zum Aufgabenkreis eines für ihn bestellten Betreuers die Vermögenssorge gehört.
Die Rolle der Ergänzungsbetreuerin ist also entscheidend, um die Rechtswirksamkeit des Widerrufs eines Testaments zu gewährleisten, insbesondere in Fällen, in denen der widerrufende Ehegatte auch der Betreuer des anderen Ehegatten ist.
Das vorliegende Urteil
AG Altötting – Az.: XVII 152/15 – Beschluss vom 08.08.2023
Zur Ergänzungsbetreuerin wird bestellt:
Frau Rechtsanwältin …
-berufliche Betreuerin-
Der Aufgabenkreis der Ergänzungsbetreuerin umfasst:
– Entgegennahme des Widerrufs eines gemeinschaftlichen Testaments
Die Überprüfungsfrist bleibt unverändert.
Bis zu einer erneuten Entscheidung gelten die getroffenen Regelungen fort.
Gründe
Der Ehemann der Betreuten trägt sich mit der Absicht, das gemeinschaftliche Testament der Eheleute zu widerrufen. Er ist Betreuer seiner Ehefrau neben einer gemeinsamen Tochter.
Diese Konstellation erfordert die Bestellung eines gesetzlichen Vertreters für die geschäftsunfähige Betroffene.
Die Erklärung des Widerrufs des gemeinschaftlichen Testaments erfolgt wie der Rücktritt von Erbvertrag durch Erklärung gegenüber dem anderen Vertragschließenden (§ 2296 BGB). Der Widerruf ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung (BeckOGK/Braun, 1.7.2023, BGB § 2271 Rn. 30), die erst wirksam wird, wenn sie dem anderen Teil zugeht. Beim Geschäftsunfähigen kann die Erklärung gegenüber dem rechtlichen Betreuer oder einem ausreichend Bevollmächtigten abgegeben werden (gem. §§ 164 Abs. 3, 131 Abs. 1, 2 BGB). Ist der andere Testierende und nun Widerrufende auch Betreuer, sollte ein anderer Betreuer bestellt werden, damit die Wirksamkeit des Rücktritts gesichert ist (vgl. BeckOGK/Müller-Engels, 1.4.2023, BGB § 2296 Rn. 15).
Nach dem psychiatrischen Gutachten vom 30.03.2022 geht das Amtsgericht von Geschäftsunfähigkeit aus: Bei der Betreuten besteht ein anhaltendes hirnorganisches Psychosyndrom mit anhaltenden mnestischen und kognitiven Funktionsstörungen bei vorbekanntem Schädelhirntrauma. Der Sachverständige beschrieb, die freie Willensbestimmung sei auch weiterhin als nicht gegeben zu beurteilen, auch im Bereich der Vermögenssorge. Von einer relevanten Besserung sei nicht auszugehen, Betreuungsbedürftigkeit werde daher dauerhaft gesehen. Anlässlich des bei der aktuellen gerichtlichen Anhörung am 04.08.2023 vor Ort gewonnenen unmittelbaren Eindrucks besteht dieser Zustand unverändert fort.
Eine Ergänzungsbetreuung war daher erforderlich, da nur so eine wirksame Erklärung gegenüber der Betreuten möglich sein wird. Es liegt hier zugleich einer der wenigen Fälle vor, in denen die rechtliche Betreuung im Drittinteresse berechtigt ist. Dies ist der Fall, wenn der Betroffene iSv § 104 Nr. 2 BGB geschäftsunfähig ist und die Betreuerbestellung für den Dritten die einzige Möglichkeit darstellt, seine Rechte diesem gegenüber zu verfolgen (vgl. BeckOK BGB/Müller-Engels, 66. Ed. 1.5.2023, BGB § 1814 Rn. 55).
Zwar ist streitig ist, ob das Gericht auch verpflichtet ist, allein zum Zwecke der Entgegennahme der Widerrufserklärung einen Betreuer gem. § 1814 Abs. 1, Abs. 3 S. 1 zu bestellen (vgl mit Nachweisen BeckOK BGB/Litzenburger, 66. Ed. 1.5.2023, BGB § 2271 Rn. 19). Dagegen wird beispielsweise eingewandt, diese Ansicht könne nicht überzeugend erklären, wie der Schutzzweck des § 2271 Abs. 1 S. 1 BGB gewahrt sein könne. Danach soll der Widerrufsempfänger durch den formalisierten Widerruf gerade in die Lage versetzt werden, auf die durch den Widerruf bedingte Unwirksamkeit zu reagieren und der veränderten Sachlage nach entsprechende Verfügungen zu treffen. Weder der Betreuer noch der Geschäftsunfähige könnten aber auf den Widerruf reagieren (Klessinger in: Praxiskommentar Erbrecht, § 2271 Widerruf wechselbezüglicher Verfügungen, Rn. 11). Der wirksame Zugang der Widerrufserklärung muss jedoch möglich sein (vgl. (BeckOGK/Braun, 1.7.2023, BGB § 2271 Rn. 47). Unterbliebe eine Betreuerbestellung, wäre dem widerrufswilligen Ehepartner das Widerrufsrecht faktisch genommen und ihm könnte das Anfechtungsrecht gem. § 2078 Abs. 2 BGB nicht länger unter Hinweis auf die Widerrufsmöglichkeit abgeschnitten werden. Der Widerruf führt zwar zum gleichen Ergebnis wie diese Anfechtung, jedoch ohne die Gefahr von Streit über die Wirksamkeit der Anfechtung. Ein Betreuungsinteresse ist gegeben, weil die mit dem Widerruf verbundene Rechtssicherheit auch für den geschäftsunfähigen Ehepartner von Vorteil ist. Auf Anregung des widerrufswilligen Ehepartners ist daher eine Betreuung zum Zwecke der Entgegennahme der Widerrufserklärung anzuordnen (BeckOK BGB/Litzenburger, 66. Ed. 1.5.2023, BGB § 2271 Rn. 19; iErg ebenso MüKoBGB/Musielak, 9. Aufl. 2022, BGB § 2271 Rn. 8). Das Amtsgericht hält dies für zutreffend. Die rechtliche Betreuung ist im Kern weiterhin als Vertretungsregelung ausgestaltet (§ 1823 BGB, §§ 164, 131 Abs.1 BGB: gesetzlicher Vertreter, dessen Vertretungsbefugnis allerdings seit der Abschaffung der Entmündigung qualitativ verändert ist und vom Selbstbestimmungsrecht geprägt wird, vgl. dazu Jürgens/Brosey, 7. Aufl. 2023, BGB § 1823 Rn. 3), welche bei Geschäftsunfähigen die rechtliche Handlungsfähigkeit im Rechtsverkehr sicherstellt. So wird gewährleistet, dass auch gegenüber einem Geschäftsunfähigen Rechte geltend gemacht werden können, beispielsweise Zivilprozesse geführt (§§ 51, 53 ZPO) und Willenserklärungen wirksam abgegeben werden können (§ 131 BGB). Umgekehrt bedeutet dies für ihn selbst Teilnahmemöglichkeit am Rechtsverkehr und liegt daher auch im eigenen (rechtlichen) Interesse, ohne dass dabei nur auf die Vorteilhaftigkeit des Ergebnisses der rechtlichen Handlungen abgestellt werden dürfte. Weitgehend unstreitig ist daher zurecht, dass in Ausnahmefällen auch nach dem Betreuungsrecht eine Betreuerbestellung möglich ist, wenn die Geltendmachung von Rechten gegen den Betroffenen infrage steht und der Dritte daran ohne die Bestellung eines Betreuers wegen (partieller) Geschäftsunfähigkeit des Betroffenen gehindert wäre (Reymann in: Herberger/Martinek/Rüßmann/Weth/Würdinger, jurisPK-BGB, 10. Aufl., § 2271 BGB (Stand: 01.07.2023), Rn. 27). Die entgegengesetzte Auffassung dürfte zum Ausschluss der Widerrufsmöglichkeit führen, sobald der andere testierende Teil geschäftsunfähig geworden ist. Nach der Formulierung des [richtig:] § 2271 Abs. 2 S. 1 BGB erlischt das Recht zum freien Widerruf wechselbezüglicher Verfügungen jedoch erst mit dem Tod des anderen Beteiligten. Der Verlust der Geschäfts- oder Testierfähigkeit ist dem nicht gleichzusetzen, sodass in diesem Falle der Widerruf möglich bleibt (BeckOGK/Braun, 1.7.2023, BGB § 2271 Rn. 46). Eine gesetzgeberische Reform ist in dieser Frage bislang schlicht nicht erfolgt (pointiert: Klessinger a.a.O.).
Die Verhinderung des Betreuers ergibt sich in vorliegender Konstellation aus Rechtsgründen. Daher ist die einzurichtende rechtliche Betreuung als sog. Ergänzungsbetreuung zu qualifizieren (§ 1817 Abs. 5 BGB). Rechtlich verhindert ist der Betreuer z.B., wenn er nach § 1824 BGB nF (ggf. iVm § 181 BGB) von der Vertretung d. Betreuten ausgeschlossen ist (vgl. für den Widerruf eines gemeinschaftlichen Testaments OLG Nürnberg NJW 2013, 2909 = ZEV 2013, 450 mAnm Keim, siehe BeckOK BGB/Müller-Engels, 66. Ed. 1.5.2023, BGB § 1817 Rn. 16). Erforderlich ist in diesem Fall somit die Bestellung eines Ergänzungsbetreuers. Dessen Aufgabenkreis kann von dem Betreuungsgericht auf die Entgegennahme der Widerrufserklärung beschränkt werden, da nur insoweit die Verhinderung des Ehegatten als Hauptbetreuer reicht (vgl. Reymann in: Herberger/Martinek/Rüßmann/Weth/Würdinger, jurisPK-BGB, 10. Aufl., § 2271 BGB (Stand: 01.07.2023), Rn. 25). Eines darüber hinausreichenden Aufgabenbereichs für die zu bestellende Betreuerin bedarf es i.Ü. nach hiesiger Auffassung nicht. Gültigkeitsvoraussetzungen des Widerrufs, etwa die Testierfähigkeit des Widerrufenden selbst, Form des Widerrufs oder Fragen der Übermittlung (z.B. bzgl. Ausfertigung nach § 47 BeurkG) sind erst gegebenenfalls im Falle von Nachlassstreitigkeiten zu klären. Die Betreute selbst ist zunächst einmal nur Empfängerin der Willenserklärung, an deren Stelle tritt die Ergänzungsbetreuerin. Darüber hinaus reichende Reaktionsmöglichkeiten unterfielen der Testierfreiheit als höchstpersönliche, nicht der rechtlichen Betreuung zugängliche Angelegenheit.
Bei der Auswahl der Betreuerin ist das Gericht dem bedenkenfreien Vorschlag der Betreuungsbehörde gefolgt. Der Widerrufende scheidet dafür nach vorstehenden Erwägungen wegen rechtlicher Verhinderung aus; für die Abkömmlinge gilt entsprechendes. Zwar ist streitig, ob § 1824 Abs. 1 Nr.1 BGB wegen der Beschränkung auf Rechtsgeschäfte auf die bloße Entgegennahme einer Willenserklärung anwendbar ist und dies zum Ausschluss von Abkömmlingen führt. In beiden Fällen ist der Interessenkonflikt bei typisierter Betrachtungsweise jedoch vergleichbar (vgl. Reymann a.a.O. Rn. 26). Eine Betreuerauswahl aus dem Kreis der Abkömmlinge der Testierenden gilt es daher jedenfalls im Ergebnis vor der Wertung der §§ 1824 Abs.1 Nr. 1, Abs. 2, 181, 1816 Abs. 3 a.E. BGB und aus Gründen der Rechtssicherheit zu vermeiden. Es war daher mangels weiterer geeigneter Personen aus dem sozialen Umfeld oder ehrenamtlich Tätigen für den punktuellen Aufgabenkreis eine berufliche Anwaltsbetreuerin zu bestellen. Diese ist im Betreuungs- und Erbrecht erfahren. Den Vorschlag aus dem Kreis der Familie nach einer bestimmten anwaltlichen Betreuerin wurde aus den nachvollziehbaren Überlegungen der Betreuungsbehörde nicht gefolgt. Innerhalb der Angehörigen gibt es sich misstrauende Lager, sodass schon der Anschein vermieden wurde, hier wäre auf die Betreuerauswahl Einfluss genommen worden.
Das Gericht hat einen Bericht der Betreuungsbehörde eingeholt.
Gemäß § 293 Abs. 3 FamFG n.F. wird von der Möglichkeit des Absehens von einem Gutachten oder ärztlichen Zeugnis Gebrauch gemacht, da die Erweiterung des Aufgabenkreises nicht auf einem veränderten medizinischen Befund beruht (vgl. Schneider, FamRZ 2022, 1, 5).
Der Betroffene wurde am 04.08.2023 in ihrer Einrichtung persönlich angehört und sich von ihr ein unmittelbarer Eindruck verschafft.
Die Verfahrenspflegerin hat sich ausführlich schriftsätzlich geäußert.